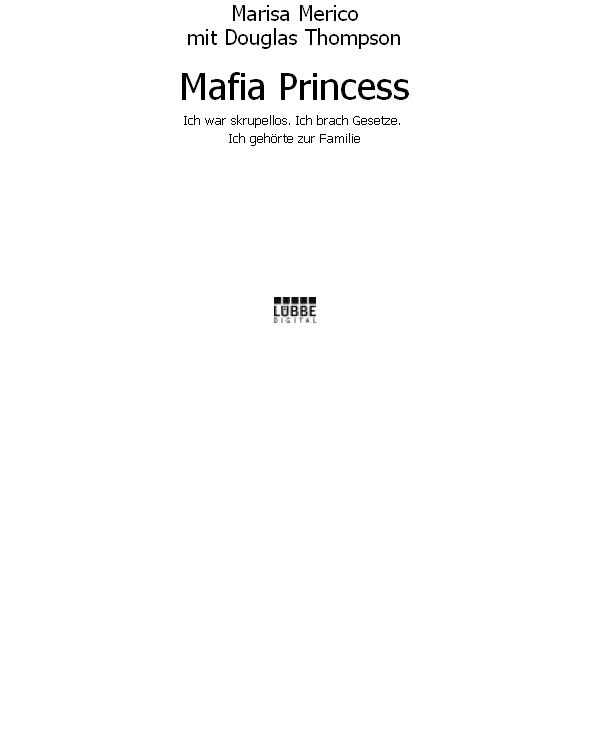![Mafia Princess]()
Mafia Princess
schickte er uns weg in die Sicherheit des Nordens, nach Mailand, mit freundlichen Worten und viel kalter Pizza.
Das war der Zeitpunkt, an dem der Mafiakrieg noch mehr ausuferte. Die Militärwaffen, die wir nach Süden gebracht hatten, hoben die Auseinandersetzungen auf ein völlig neues technisches Niveau; bombensichere Autos halfen nun nichts mehr, und die De Stefanos hatten buchstäblich keine Ahnung, was sie getroffen hatte, als Bazookas und Panzerabwehrgranaten ins Spiel kamen. Domenico Libri überlebte nur knapp einen Bazooka-Angriff, den Onkel Domenico organisiert hatte.
Es war jedoch bei weitem nicht alles so einseitig. Onkel Domenico fuhr damals in einem kugelsicheren Wagen mit Leibwächtern herum, oft mit dunkler Brille, einem falschen Bart und einer Perücke getarnt. Doch die Geduld zahlte sich für seine Killer aus. Sie warteten in aller Ruhe ab, die Zeit spielte ihnen in die Hände, und dann brach Onkel Domenico seine Routine und zeigte sich. Er schlenderte auf den Balkon seines Schlafzimmers, um eine Zigarre zu rauchen.
Ganz plötzlich waren die Attentäter nur zehn Meter entfernt.
Mit Gewehren Kaliber 12 streckten ihn die Kapuzenmänner nieder. Als ich davon erfuhr, stand ich erst mal unter Schock. Es war furchtbar. Er war ein wunderbarer Mann gewesen. Unter all meinen Verwandten war er mir einer der liebsten; manche mag man sehr gern, andere weniger, aber er war großartig, und nur wenige Monate nach unserem Waffentransport wurde er ermordet.
Der Rachefeldzug kam schnell. Giovanni Firca war Juwelier, bekannt als der Goldschmied , und ein Geldmann von der anderen Seite. Er saß komfortabel in seinem Nissan Offroader, der durch mehrere Schichten Stahl gepanzert war. Weshalb auch die erste Bazooka den Wagen nicht zerfetzte. Der zweite Bazooka-Treffer aber riss die Vorderseite weg, und der Wagen ging in Flammen auf. Firca überlebte, Gott weiß wie, aber viele andere schafften es nicht. Die Gegend war Kriegsgebiet, und die Carabinieri trauten sich nicht hinein.
Jede Nacht hörte ich aufgeregte Telefonate mit, in denen es um Neuigkeiten aus dem Süden ging. Die Polizei erschien am Tatort immer nach den Ereignissen, fand aber nie irgendwelche Hinweise. Eines wussten sie allerdings – die Munition, die bei manchen Angriffen eingesetzt wurde, stammte aus Bazookas, die in Jugoslawien »verloren gegangen« waren.
Mum rief oft aus England an und redete am Telefon unablässig auf mich ein. Ich gab mir Mühe, die Todesfälle vor ihr zu verschweigen, aber sie hatte innerhalb der Familie ihr eigenes Informationsnetzwerk. Ich versuchte, das Ganze als etwas abzutun, was da unten im Süden passierte, während ich doch in Mailand war. Aber jedes Telefonat war angespannt, und wir schienen nicht in Ruhe miteinander reden zu können. Eine von uns sagte ständig etwas, was die andere auf die Palme brachte.
Einmal beschwichtigte ich ihre Sorgen, indem ich erklärte: »Es ist doch bloß eine Vendetta , Mum.«
Bloß eine Vendetta ! Tragik und Gewalt waren normales Familienleben.
Auch Mum hatte das erlebt. Sie wusste Bescheid. Es wäre besser gewesen, wenn wir gar nicht darüber gesprochen hätten, aber das wollten wir beide nicht. Andauernd brachte mich Mum auf die Palme. Ihre Sorgen musste sie dabei gar nicht erst aussprechen. Sie waren immer da.
Ich hatte Angst davor zu sterben. So viele Leute um mich herum wurden erschossen. Alles passierte in rasanter Geschwindigkeit, das Waffenschmuggeln, das Drogenschmuggeln, das Geldschmuggeln. Ich war in einem Mafia-Marathon.
Ich zog mich in Mailand zurück. Auch Großmutter musste vorsichtig sein. Sie schickte Geld – viele Millionen Dollar wurden in die Fehde gesteckt – und Waffen. Mit Bazookas bahnten wir uns unseren Weg zum Sieg; die militärische Ausrüstung und das Bargeld, das mein Vater seinen Truppen schickte, waren der entscheidende Faktor bei diesem speziellen Territorialkrieg, der noch vor meinem einundzwanzigsten Geburtstag vorbei war.
Inzwischen hielt Dad den Holländer, und vor allem dessen Tochter, bei Laune. Regelmäßig besuchten wir sie in der Schweiz.
Einmal fiel mir auf, dass Cranendonks Tochter einen Cartier-Ring am Finger trug, mit einem gewaltigen Stein, und ich sagte: »Schönen Ring hast du da.«
»Ach, den hat mir dein Vater geschenkt.«
»Oh, aha, schön.«
»Bestimmt kauft er dir auch einen.«
Für mich war das in Ordnung. Sie war ja schließlich seine Freundin. Aber sie redete und redete, sagte immer wieder, er würde mir auch einen
Weitere Kostenlose Bücher