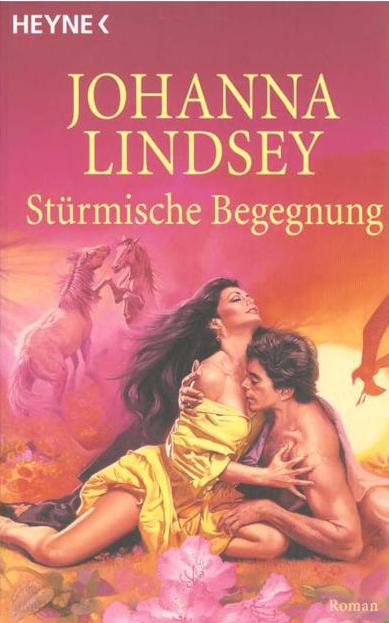![Malory]()
Malory
ausgeben, daß sich erst viel später beweisen läßt, wenn du schon lange von hier fort bist.«
»Ein kluger Mann.« Sie lächelte und fühlte sich nicht im mindesten gekränkt. »Aber ich sehe nicht in die Zukunft.«
»Nein?« Er hob eine blonde Braue. »Aber was siehst du dann, wenn du Hellseherin bist?«
»Ich sehe die Menschen als das, was sie sind, und kann ihnen helfen, sich selbst in einem klareren Licht zu sehen, damit sie ihre Schwächen erkennen können und glücklicher mit ihrem Los werden.«
Diese phantasievolle Erklärung amüsierte ihn. »Mich selbst kenne ich gut genug.«
»Wirklich?«
Sie fragte so eindringlich, daß er stutzte. Dann schüttelte er aber die Neugier ab, die ihn plötzlich bei dieser Frage überkam. Er ließ sich nicht an der Nase herum-führen. Diese Leute verdienten ihren Lebensunterhalt damit, sich Unwissenheit und Aberglaube anderer zunutze zu machen. Dafür war er der Falsche. Und au-
ßerdem hatte sie den Dienst, den sie ihm erweisen wollte, noch nicht näher erklärt.
»Ich habe ein paar Münzen dabei«, sagte er obenhin.
Du wirst doch sicherlich noch anderes feilbieten, das für mich von Interesse wäre.«
Da seine Augen über ihren Körper wanderten, ließ er kaum Zweifel darüber aufkommen, was er von ihr wollte. Ein Blick, der eine Dame beleidigt hätte. Die Kleine aber schien nicht gekränkt zu sein, nicht im mindesten. Sie lächelte, als ob sie sich über seinen so unverhohlen zur Schau getragenen Wunsch freute.
Aber die Antwort, die er jetzt zu hören bekam, brachte ihn aus dem Gleichgewicht.
»Ich bin nicht käuflich.«
Wie vom Donner gerührt saß er da. Es wäre ihm nicht im Traum eingefallen, daß er sie nicht haben konnte.
Seine Gefühle gerieten in Aufruhr; er weigerte sich, aus ihrem Mund ein Nein zu akzeptieren.
Es hatte ihm die Sprache verschlagen, so daß Anastasia nach einer Weile glaubte, etwas sagen zu müssen.
»Was nicht bedeutet, daß Sie mich nicht haben können ...«
»Ausgezeichnet!« unterbrach er sie.
»Jedoch würde Ihnen die Bedingung, die damit verbunden ist, nicht gefallen, also lohnt es sich nicht, dar-
über zu sprechen.«
Da Christophers Gefühlswelt schon ziemlich lange ab-gestumpft war, wußte er nicht, wie er mit diesen Wechselbädern umgehen sollte, die ihm die Zigeunerin in diesem Augenblick bescherte.
Er entschloß sich zu einem finsteren Stirnrunzeln und strengem Tonfall. »Was für eine Bedingung?«
Sie seufzte. »Es ist sinnlos, sie zu erwähnen, da Sie niemals darauf eingehen würden.«
Sie wandte sich von ihm ab und erhob sich, als ob sie fortgehen wollte. Er packte sie am Arm und hielt sie davon ab. Er würde sie bekommen, das stand für ihn außer Zweifel. Aber es machte ihn plötzlich zornig, da sie offensichtlich versuchte, ihn zu necken, um den Preis in die Höhe zu treiben.
»Wieviel wird es mich kosten?« fragte er scharf.
Bei diesem Ton zuckte sie unmerklich zusammen, unternahm aber nichts, um ihn zu beschwichtigen, und stellte ihm statt dessen eine Gegenfrage. »Warum muß alles einen Preis haben, Lord Engländer? Es war falsch von Ihnen zu denken, ich sei wie die anderen Frauen.
Mit einem Gajo zu schlafen, bedeutet ihnen nichts. Es ist nur eine weitere Art des Broterwerbs.«
»Und was macht dich anders?«
»Ich bin nur zur Hälfte Zigeunerin. Mein Vater war ein Adliger wie Sie, wenn nicht sogar von höherem Adel. In seinem Land war er ein Prinz. Von ihm habe ich andere Anschauungen übernommen. Zum Beispiel wird mich ein Mann nur berühren, wenn er mich heiratet. Verstehen Sie jetzt, warum ich sage, es habe keinen Sinn, darüber zu sprechen? Sie würden nicht nur in eine Heirat mit mir einwilligen müssen, Sie müßten auch meine Großmutter überzeugen, daß Sie meiner würdig sind, und ich sehe nicht, daß eines von beiden eintreten wird. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen ...«
Er wollte sie nicht gehen lassen. Eine Ehe mit ihr kam natürlich nicht in Frage. Das hatte sie ja bereits selbst ausgeschlossen. Ein Vater, der von Adel war. Was für eine freche Lüge! Und trotzdem wollte er sie noch immer. Es mußte eine andere Möglichkeit geben, sie zu bekommen. Ihm würde schon etwas einfallen. Sie durfte jetzt nur nicht weggehen.
Aus diesem Grund bat er sie: »Erzähle mir mehr über deine Hellseherei.«
Sie ließ sich gar nicht erst darauf ein. »Warum sollte ich, wenn Sie mir nicht glauben?«
Er lächelte sie offen an und hoffte, sie damit zu besänftigen. »Überzeuge
Weitere Kostenlose Bücher