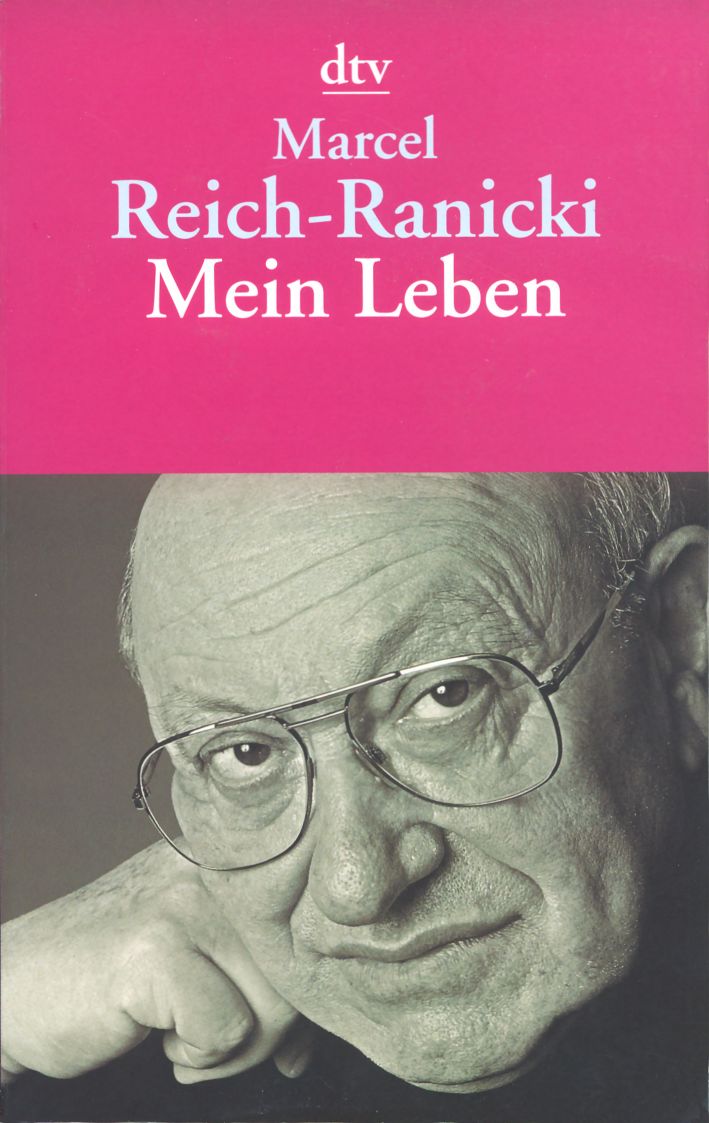![Mein Leben]()
Mein Leben
ihm vom Erziehungsminister Rust der Entwurf eines »Judenschulgesetzes« vorgelegt, das die Absonderung der jüdischen Schüler nach rassischen Kriterien vorsah. Dies aber hätte dazu geführt, daß die im Sinne der Nürnberger Gesetze jüdischen Kinder, die christlichen Glaubens waren, nur jüdische Schulen hätten besuchen dürfen – wogegen der Primas der katholischen Kirche im Reich, der Breslauer Kardinal Betram, protestierte. Um die Beziehungen zur katholischen Kirche nicht zusätzlich zu belasten, zog es Hitler vor, das »Judenschulgesetz« zumindest zu verschieben.
Kaum weniger fürchtete ich, eines Tages werde man den Juden den Besuch der Theater und Opernhäuser verbieten. Damit wäre ich aus meinem wunderbaren Zufluchtsort verjagt worden, aus meinem elfenbeinernen Turm. In der Tat wurde den Juden seit dem 12. November 1938 der Zutritt – so in einer Bekanntmachung der Reichskulturkammer – zu »Theatern, Lichtspielunternehmen, Konzerten, Vorträgen, artistischen Unternehmen, Tanzvorführungen und Ausstellungen kultureller Art mit sofortiger Wirkung« untersagt. Da war ich allerdings nicht mehr in Berlin.
Was sollte aus mir werden? Diese Frage lastete auf meiner ganzen Jugendzeit, am stärksten naturgemäß im letzten Schuljahr und, noch schlimmer, nach dem Abitur. Für die anderen, die nichtjüdischen Schüler, war das Abitur die lange erwartete, die geradezu ersehnte Erlösung vom Schulzwang. Und für mich? Natürlich habe ich von allerlei Berufen geträumt. Dozent oder Professor für deutsche Literatur – das wäre, dachte ich mir, ein fabelhafter Beruf. Oder vielleicht eine Tätigkeit in der Dramaturgie? Das schien mir unerhört reizvoll, weil beide Bereiche, denen mein intensivstes Interesse galt – die Literatur und das Theater –, vereint wären. Ein Ziel, aufs innigste zu wünschen, das war ein anderer Beruf, einer, der im »Dritten Reich« verpönt war: Kritiker. Es waren Träumereien, deren ich mich schämte und über die ich mit niemandem zu sprechen wagte. Ich fragte meine Familienangehörigen, was mit mir geschehen solle? Niemand wußte eine Antwort. Mein Vater, mittlerweile in Warschau, war nicht imstande, sich um mich zu kümmern, meine Mutter war ratlos.
Meine fünf Berliner Cousins und Cousinen, allesamt ungefähr in meinem Alter, hatten es gut: Sie wurden auf Colleges in England geschickt. Dort haben sie den Zweiten Weltkrieg überlebt. Auch mich hätte man ohne weiteres nach England schicken können, aber dazu war Geld nötig, ein bestimmter, nicht einmal so hoher monatlicher Betrag, dessen Zahlung freilich garantiert sein mußte. Doch davon konnte bei uns nicht die Rede sein.
Jeder Schüler, der die Reifeprüfung abzulegen wünschte, mußte ein Gesuch einreichen, in dem er anzugeben hatte, was er nach der Schule zu tun gedenke. Ich schrieb, daß ich Germanistik und Literatur studieren wolle. Auf meinem »Zeugnis der Reife« heißt es denn auch: »Reich will auf der Universität studieren.« In der Tat hielt es meine Mutter für nicht ganz ausgeschlossen, daß ich als polnischer Staatsangehöriger das Studium an der Berliner Universität werde wenigstens beginnen können. Es war eine naive, eine weltfremde Vorstellung, die wohl damit zusammenhing, daß mein Bruder 1935 noch in Berlin promovieren konnte. So reichte ich ein Immatrikulationsgesuch ein und bekam von der Friedrich-Wilhelm-Universität, wie nicht anders zu erwarten, einen abschlägigen Bescheid.
Um der Weltfremdheit die Krone aufzusetzen: Ich habe noch – von meiner Mutter gedrängt – um ein Gespräch mit dem Rektor der Berliner Universität nachgesucht. Es wurde mir, was mich heute noch wundert, sofort bewilligt, er hat mich empfangen und war überaus höflich. Offenbar wollte er nicht sagen, daß Juden zum Studium nicht mehr zugelassen seien. Er hat sich daher bloß auf den Mangel an freien Studienplätzen berufen.
Was mir damals verweigert wurde, habe ich nie nachgeholt – ich habe nie an einer Universität studiert. Einen Universitäts-Hörsaal habe ich erst Jahrzehnte später zu sehen bekommen: 1961 in Göttingen. Ich hatte dort eine Vorlesung zu halten. So kenne ich die Hörsäle nur aus der Perspektive des Katheders. Das Gebäude der Friedrich-Wilhelm-Universität – nach dem Zweiten Weltkrieg Humboldt-Universität genannt – habe ich seit jenem überflüssigen Besuch beim Rektor im Frühjahr 1938 nicht wieder betreten.
Schließlich gab es doch eine Tätigkeit für mich, allerdings eine, die mit allem,
Weitere Kostenlose Bücher