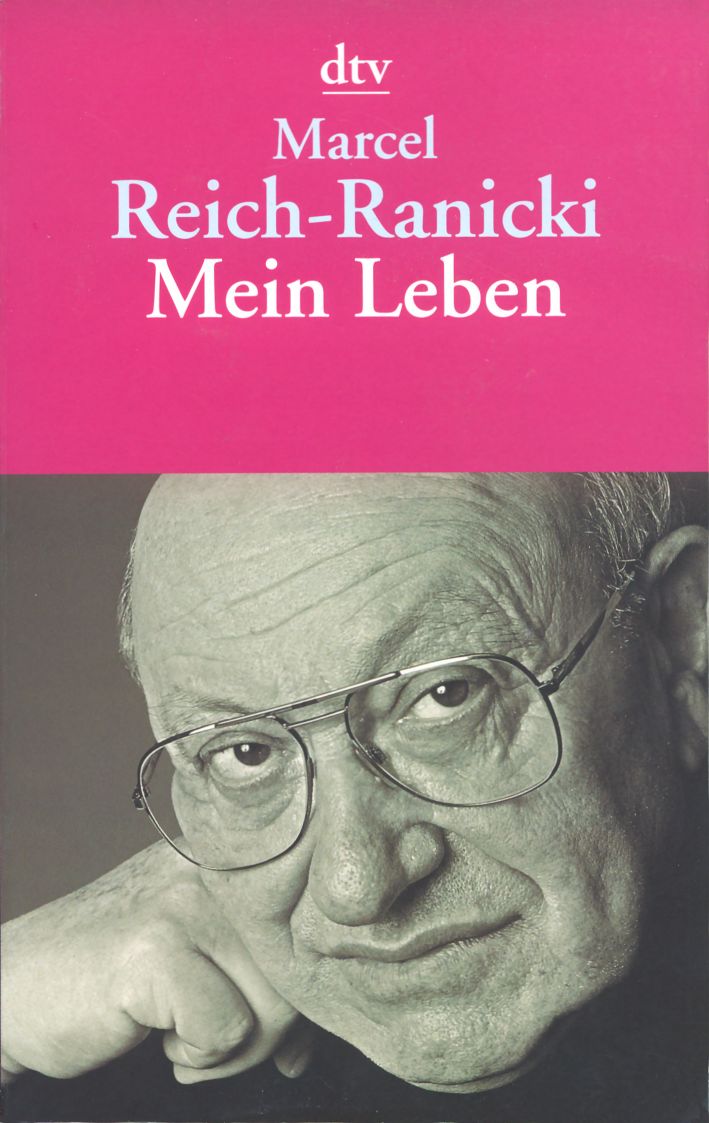![Mein Leben]()
Mein Leben
hatte Angst. Aber die Aufgabe gefiel mir. So stimmte ich zu, vorerst nur für zwei oder drei Wochen. Doch kam es anders, und ich schrieb regelmäßig die Konzertbesprechungen in dieser Zeitung – bis es keine Konzerte mehr gab. Ganz wohl war mir dabei nicht. Zwar hatte ich vor dem Krieg schon viel Musik gehört (meist im Rundfunk und von Schallplatten). Auch verfügte ich über ziemlich gute Kenntnisse der Musikgeschichte. Daß ich aber erfahrene und zu einem nicht geringen Teil längst anerkannte Künstler öffentlich beurteilte, wenn auch mit Gewissensbissen – das war schon ein starkes Stück, genauer: eine Frechheit. Ich wußte es, ich tat es dennoch. Wenn ich heute meine damaligen Artikel lese, schäme ich mich. Es geht nicht um den Stil, obwohl ich, man kann es kaum glauben, Beethoven einmal einen »Titanen« genannt habe und Schubert einen »großen Meister«. Derartiges lesend, erröte ich noch heute. Schon gar nicht geht es darum, daß der zwanzigjährige Rezensent bisweilen etwas reichlich lobte und rühmte. Aber wozu habe ich dies und jenes beanstandet und getadelt? Wozu habe ich Musikern, die sich redlich mühten, Schmerzen bereitet?
Vielleicht kann zu meiner partiellen Entlastung beitragen, daß ich, dessen bin ich ganz sicher, nie leichtfertig geschrieben habe und mich überdies von dem Kenner, den ich zunächst nur für kurze Zeit vertreten sollte, regelmäßig habe beraten lassen. Aber wenn ich bedenke, was diese jüdischen Musiker kurz nach den Konzerten erlitten haben, tut mir jedes skeptische oder gar negative Urteil, das ich damals gefällt habe, noch heute leid. Manche Äußerungen sind mir nicht mehr verständlich. So schreibe ich respektvoll über eine Aufführung von Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag, die jedoch »aus Gründen, die von dem Jüdischen Symphonieorchester‹ unabhängig sind, nicht zu Ende gespielt werden konnte«. Was wollte ich andeuten und doch nicht sagen? Hat die Beleuchtung versagt? Oder waren etwa Deutsche gekommen und haben uns auseinandergetrieben? Nein, denn das hätte ich nicht vergessen.
An ein anderes Konzert, das tatsächlich von Deutschen heimgesucht wurde, kann ich mich sehr wohl erinnern. Man spielte die große g-moll-Symphonie von Mozart. Während der ersten Takte des vierten Satzes geschah etwas Ungewöhnliches: Zwei oder drei Deutsche in Uniform betraten den Saal. Das hatte es noch nie gegeben. Alle erstarrten, auch der Dirigent sah es, doch dirigierte er weiter. Nie im Leben habe ich diesen letzten Satz der g-moll-Symphonie mit einem so deutlichen Tremolo in den Geigen und Bratschen gehört. Nicht die Konzeption des Dirigenten war es, es war die Furcht der Musiker. Man konnte ja nicht wissen, was die Deutschen jetzt tun würden. Werden sie gleich brüllen: »Raus, raus«? Würden sie alle zusammenschlagen? Würden sie es für empörend halten, daß Juden Musik machten, würden sie gar von ihren Waffen Gebrauch machen?
Aber sie standen da und taten vorerst nichts. Das Orchester spielte die Symphonie zu Ende. Dann klatschte das Publikum, zögernd und wohl ängstlich. Und nun passierte etwas absolut Unerwartetes, ja Unbegreifliches. Die zwei oder drei Männer in Uniform, sie haben nicht gebrüllt, sie haben nicht geschossen: Sie haben geklatscht und sogar freundlich gewinkt. Dann entfernten sie sich – ohne jemandem etwas angetan zu haben. Deutsche waren es, und sie haben sich dennoch wie zivilisierte Menschen verhalten. Darüber sprach man im Getto noch wochenlang.
Die Konzerte waren immer gut besucht, die Symphoniekonzerte meist überfüllt. Der Not zum Trotz? Nein, nicht Trotz trieb die Hungernden, die Elenden in die Konzertsäle, sondern die Sehnsucht nach Trost und Erbauung – und so verbraucht diese Vokabeln auch sein mögen, hier sind sie am Platz. Die unentwegt um ihr Leben Bangenden, die auf Abruf Vegetierenden waren auf der Suche nach Schutz und Zuflucht für eine Stunde oder zwei, auf der Suche nach dem, was man Geborgenheit nennt, vielleicht sogar nach Glück. Sicher ist: Sie waren auf eine Gegenwelt angewiesen.
So ist es kein Zufall, daß zu den beliebtesten Werken Beethovens neben der »Eroica«, der Fünften und der Siebten die »Pastorale« gehörte: Wo es keine Wiesen gab und keine Wälder, keine Bäche und keine Büsche, lauschten viele, die sonst wenig für Beethovens Programmmusik übrig hatten, dankbar dem »Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande« und anderen idyllischen Szenen – und sie waren dankbar nicht
Weitere Kostenlose Bücher