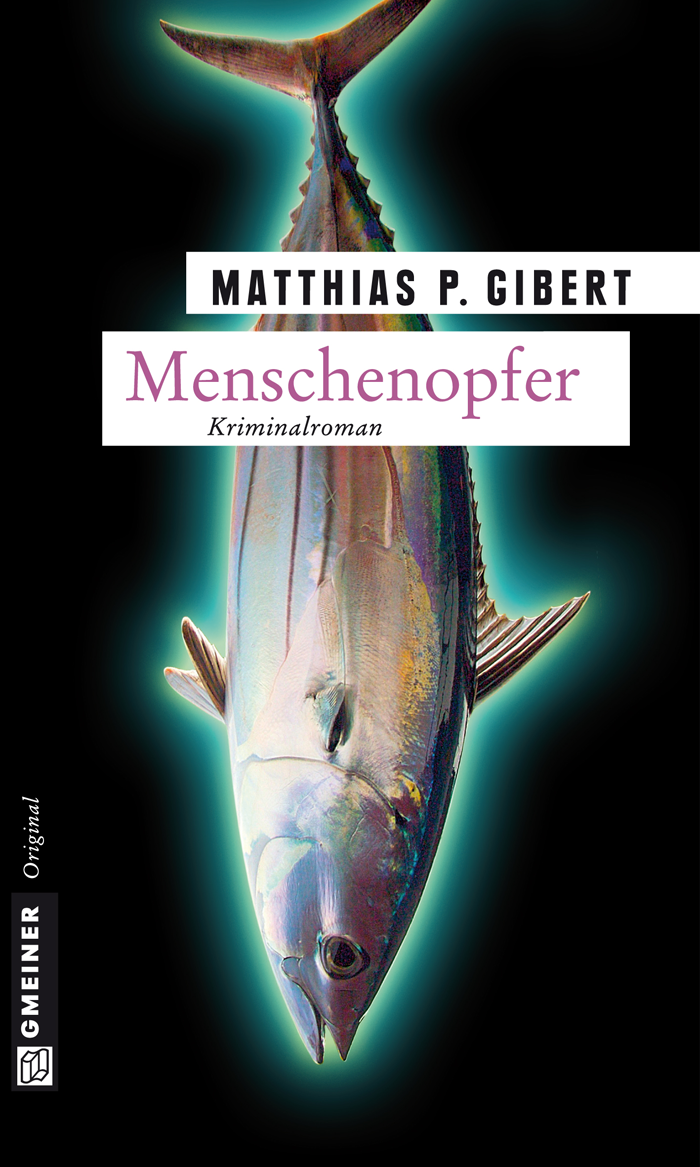![Menschenopfer - Gibert, M: Menschenopfer]()
Menschenopfer - Gibert, M: Menschenopfer
Offenbacher hinter sich, dass einem schlecht werden konnte, und hatten Angst, dass der Vermieter sie über die Schufa oder so prüfen lässt.«
Lenz verstand nur Bahnhof, und diesen Gemütszustand drückte vermutlich auch sein Gesicht aus, was wiederum die Frau zu einer tiefer gehenden Erklärung animierte.
»Offenbarungseide!«, klärte sie die Polizisten auf. »Die beiden hatten jede Menge Offenbarungseide am Hacken. Und weil mancher Vermieter das gar nicht lustig findet, haben sie mich als Strohmann benutzt.«
Sie stutzte.
»Oder sagt man besser, Strohfrau?«
»Da ist die deutsche Sprache nicht so pingelig, vermute ich mal«, wurde sie von Lenz beruhigt.
»Na ja, ist eigentlich auch egal. Mir ist jetzt nur noch wichtig, dass ich irgendwo ein Nickerchen machen kann, das keinesfalls vor sechs oder sieben heute Abend zu Ende sein sollte. Also in welches Hotel stecken Sie mich?«
Nun machte der Polizist ein trauriges Gesicht.
»Ein Hotel ist leider nicht drin, Frau Dörrbecker. Was ich Ihnen anbieten könnte, ist ein kleiner Raum im Präsidium; praktisch ein Einzelzimmer. Und die Bewachung ist wirklich perfekt.«
Hain drehte langsam den Kopf in die Richtung seines Chefs, verdrehte leicht die Augen, schluckte, ließ jedoch keinen Ton vernehmen.
»Wie jetzt, im Präsidium? Diese Scheiße ist doch wohl nicht Ihr Ernst? Das klingt ziemlich nach Ausnüchterungszelle, wenn Sie mich fragen.«
»Mehr kann ich Ihnen für den Augenblick leider nicht anbieten. Wir wissen ja nicht einmal, ob die Verwüstung Ihrer Wohnung und die Sache hier in einem Zusammenhang stehen.«
»Im Bullenstall wollt ihr mich unterbringen«, zischte sie den Beamten entgegen. »Aber da könnt ihr einen großen Haken dran machen, Jungs.«
Damit stapfte sie ein paar Schritte zur Seite, griff zu ihrem Mobiltelefon und wählte eine Nummer.
»Ja, ich bin’s, die Illi. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen?«
33
Yoko Tanaka schmeckte Blut in ihrem Mund. Mit zitternden Lippen öffnete sie die Augen, konnte jedoch nichts erkennen, weil alles um sie herum in tiefer Dunkelheit lag. Etwas streifte ihre Haare, sodass sie sich erschreckte und es wegwischen wollte, dabei stellte sie fest, dass es der zusammenfallende Airbag aus dem Lenkrad war. Irgendwo in der Ferne zischte etwas unheilvoll, und sie hätte schwören können, dass es nach Benzin roch. Über ihrem linken Arm stöhnte etwas, und nach einem kurzen Blick war klar, dass ihr Großonkel der Verursacher des Jammerns war. Sie schob die weiße Hülle des Luftsacks zur Seite und sah zur Beifahrerseite, von wo sie schemenhaft das blutleere Gesicht von Mata Aroyo anstarrte.
»Du blöde, kleine Schlampe«, flüsterte die Frau kaum vernehmbar.
Yoko betrachtete ihre Vorgesetzte mit einer Mischung aus Genugtuung und abgrundtiefem Hass.
»Das kannst du dem Gericht erzählen«, erwiderte sie. »Und ab heute wirst du mir keine Befehle mehr geben.«
Die Geliebte des Unternehmers griff nach ihrer Hand.
»Sei nicht blöd, du Flittchen. Was du vorhast, ist ein paar Nummern zu groß für dich.«
Die junge Japanerin nahm den Druck ihres Armes auf, brachte sich in eine aufrechte Position und atmete tief durch. »Du bist im Arsch, Mata. Besser, du siehst es ein.«
»Hallo?«, kam es in diesem Moment von hinter der Limousine. »Können Sie mich hören?«
Yoko sah nach hinten und konnte durch die Heckscheibe erkennen, dass sich zwei uniformierte Polizisten dem Wagen näherten.
»Sind Sie verletzt? Hallo?«
»Ja«, rief Mata Aroyo zurück. »Ich bin verletzt. Und ich werde von der Frau bedroht, die für den Unfall verantwortlich ist.«
»Nein, das stimmt nicht«, rief Yoko.
Neben dem Wagen flammten Taschenlampen auf, während sich die beiden Polizisten der Fahrertür näherten. Ihre Schritte wurden begleitet vom Geknirsche der zerborstenen Scheiben, die sich in Form Abertausender Scherben unter ihren Füßen breitmachten.
Daijiro Tondo stöhnte erneut auf. Offenbar hatte ihm der Aufprall am heftigsten zugesetzt.
»Bitte, beschützen Sie mich vor dieser Irren«, jammerte Mata Aroyo laut los. »Ich habe Angst, dass sie mir etwas antut.«
Einer der Polizisten riss und rappelte an der Fahrertür, die sich jedoch nicht öffnen ließ. Also krabbelte sein Kollege über die Motorhaube und machte sich an der Beifahrertür zu schaffen, die ihm nach ein paar kräftigen Schlägen entgegensprang.
»So, und nun bleiben wir alle vernünftig und warten, bis der Notarzt hier ist.«
Daran dachte die Geliebte von
Weitere Kostenlose Bücher