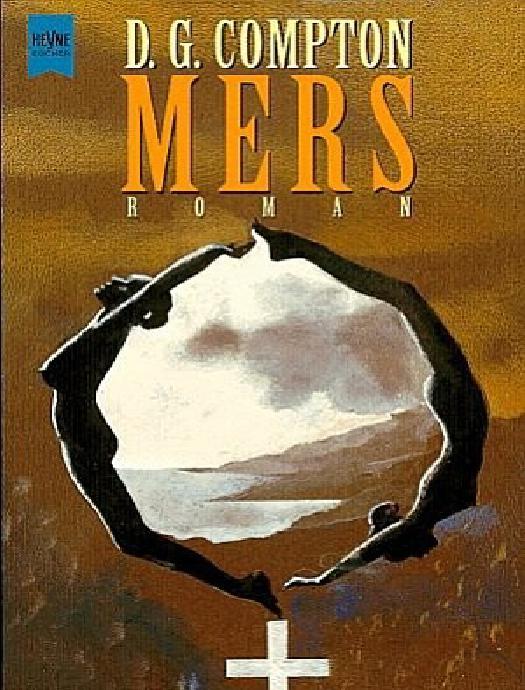![MERS]()
MERS
Sie meinen.« Sie hatte ein kleines
Offiziersstöckchen bei sich, mit dem sie rasch auf ihre
Hosenbeine einschlug, während sie sich im Raum umschaute. Sie
entdeckte die Flasche auf meinem Schreibtisch, ging dann weiter und
ließ, wie vorherzusehen gewesen war, den Blick auf Anna und den
Papieren ruhen. »Ihre Tochter hat Ihnen geholfen. Wie lautet
genau der Sicherheitscode für Ihre Tochter?«
Sie wirkte etwas lächerlich. Sie hatte das letzte Mal etwas
lächerlich gewirkt – anfangs.
»Sie haben von einer Routineangelegenheit gesprochen,
Sergeant Milhaus.« Beim Aussprechen dieses Namens wurde mir
übel. Ich war so wütend und hatte soviel Angst um Anna,
daß ich kaum Luft bekam. Alles war möglich. Bei Sergeant
Milhaus war alles möglich.
»Sicherheit, Dr. Ryder. Ihre Tochter, Ihre Papiere, Ihr
Büro. Die Ministerin hat den Eindruck, als ob…«
»Sind Sie die Person, die meine Katze getötet hat?«
Anna hatte die Augen weit geöffnet, und ihre Fingerknöchel
auf der Lehne meines Stuhls waren weiß. »Sind Sie’s?
Sind Sie’s?«
Sergeant Milhaus ließ sich nicht zur Eile drängen.
»Du bist Anna. Wir sind uns noch nicht begegnet. Ich bin
Sergeant Milhaus.«
»Wir sind uns begegnet. Sie haben eine dunkle Brille
getragen und mir eine Wanze auf die Stirn geklebt. Haben Sie meine
Katze getötet?«
»Katzen sterben, Anna. Wenn nicht heute, dann morgen. Katzen
und andere Tiere. Wenn nicht morgen, dann heute.«
»Sie sind abscheulich.«
»Ich bin im Dienst. Nun, wie ich gerade sagen
wollte…« Sie schritt an Gusso vorbei zum Drucker und hob
einen Ordner mit dem Ende ihres Stöckchens an. »Ihre
Sicherheitsvorkehrungen, Dr. Ryder. Die Ministerin hat das
Gefühl, sie könnten etwas besser sein. Die Arbeit hier ist
von nationaler Bedeutung. Die Ministerin wünscht ihre
Verbreitung nicht.«
»Meine Sicherheitsvorkehrungen sind ausgezeichnet.« Wenn
Anna zurückschlagen konnte, so konnte ich es auch. »Aber
Sie sind nicht deswegen hier. Das ist nur eine Ausrede. Professor
Polder ist mein Zeuge. Sie sind hier, um mich zu bedrohen und
einzuschüchtern.«
Sie ließ sich auf keine Diskussion ein. War
unerschütterlich. »Dies ist das Zeitalter biotechnischer
Überwachungsmethoden – Mikrofone, Kameras von der
Größe eines Insektenauges. Sie sollten diesen Raum
säubern lassen.«
Gusso trat vor. »Darf ich Ihre Kennkarte sehen, Sergeant?
Oder ist die auch biotechnisch gefertigt und insektengroß? Und
Ihre Dienstnummer? Fairerweise will ich Ihnen sagen, daß ich
die Absicht habe, bei Ihren Vorgesetzten Beschwerde
einzureichen.«
Ich fühlte mich besser. Er war so sarkastisch und formal.
Sergeant Milhaus gab ihm ihre Karte, wartete, während er sich
Notizen auf einem Zettel von meinem Schreibtisch machte, und nahm die
Karte dann wieder entgegen.
»Kameras von der Größe eines Insektenauges. Auch
Mikrofone. Alle Büros sollten gesäubert werden.«
Zwischen den Fenstern hing ein Bild in einem verchromten Rahmen,
ein breites, stilisiertes Schwarzweißfoto der Mitternachtssonne
hinter Tannen. Sergeant Milhaus hob es mit dem Ende ihres
Stöckchens von der Wand weg und spähte dahinter. Sie hob es
immer weiter von der Wand weg, bis sich der Aufhänger löste
und das Bild auf den niedrigen Schiefertisch darunter fiel. Das Glas
zersplitterte klirrend an der Kante des Tischs zu langen Dolchen, und
diese Dolche zersplitterten erneut, als sie auf die Fliesen fielen.
Die Wand, woran das Bild gehangen hatte, war sauber und sehr glatt.
Nicht einmal eine Kamera so groß wie ein Insektenauge.
Sergeant Milhaus blieb gelassen. Sah gar nicht richtig hin. Sie
war hier, um Sachen zu zerbrechen. Um mich zu zerbrechen.
»Kameras befinden sich oft hinter Bildern.« Sie blickte
aus dem Fenster, auf den stillen Steingarten. »Richtmikrofone
können von der Oberfläche des Glases jedes hier drin
gesprochene Wort auffangen. Die Ministerin ist besorgt.«
Brüsk schritt sie zur offenen Tür, hielt auf der
Schwelle inne und wandte sich um. Ich erwartete, sie würde mir
sagen, wohin ich die Rechnung für das zerbrochene Glas schicken
sollte.
»Ich bin eine Dienerin des Staats, Dr. Ryder. Wie Sie. Wir
tun, was wir können, nicht wahr?«
Bisher hatte ich sie heute noch nicht wegen meines Namens
korrigiert, und ich tat’s jetzt auch nicht. Ich wartete,
daß sie ginge. Während sie sich die Polizeimütze
wieder aufsetzte, ging sie. Sie lungerte nicht herum. Sie war gut im
Abgehen, gut bei allem, was sie tat.
Anna neben mir weinte. Gusso
Weitere Kostenlose Bücher