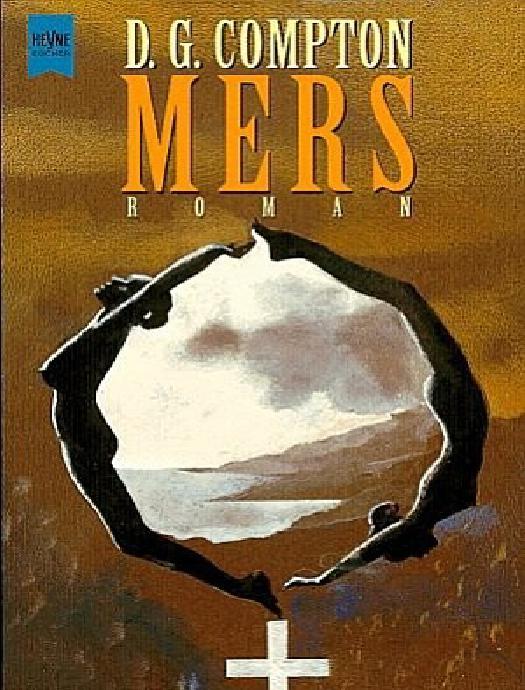![MERS]()
MERS
einem Ort wie diesem hier war Vertrauen wichtig.
»Ich fange wohl lieber nicht mit einer Lüge an, Mama.
Ich…«
»Natürlich nicht, meine Liebe.« Sie tätschelte
mir die behandschuhte Hand. »Dieser Vorschlag von mir war
häßlich. Sag ihr einfach, du hast familiäre
Gründe.« Erneut flüsterte sie. »Dann wird sie
glauben, es hat etwas damit zu tun, deine Ehe zu
retten…«
Sie richtete sich auf, funkelte mich an und sagte laut: »Es
hat nichts damit zu tun, deine Ehe zu retten, nicht
wahr?«
Ich lachte. »Nein, Mama. Das verspreche ich. Mark und mir
geht es gut…«
»Dann ist es in Ordnung.« Sie entspannte sich und
klopfte sich mit einer für eine geschorenen Nonne seltsam
matronenhaften Geste auf die Brust unter ihrem braunen Hemd.
Daraufhin stützte sie die Ellbogen auf den Tisch und sah mich
erwartungsvoll an.
»Wie geht’s dir also, Mama?« fragte ich. »Was
macht Tochter Pasquale?«
Tochter Pasquale, die in der Küche arbeitet, war das Kreuz,
das Mama trug. Sie war eine fette, fröhliche Person, die keine
Ahnung hatte, wie man etwas richtig machte. Sie räumte die
Geschirrspülmaschine falsch ein, und Mama mußte hinter ihr
herräumen.
»Pasquale geht’s nicht gut, Harri. Sie verliert an
Gewicht. Ich mache mir Sorgen um sie…«
Ich hörte mir ihre Symptome an, die vorgeschriebene
Behandlung und die Gebete, die für sie gesprochen wurden. So,
wie die beiden ersten Sachen sich anhörten, waren die Gebete
für sie die beste Hoffnung. Arme Tochter Pasquale, und arme
Mama…
Unsere fünfzehn Minuten neigten sich dem Ende zu. Eine
taktvolle Warnglocke erinnerte uns daran, und Mama stand auf. Wir
umarmten uns erneut, und sie schritt rasch zur Tür. Dort hielt
sie inne.
»Hast du etwas Neues von deinem Bruder erfahren,
Harri?«
Ich dachte daran, wie oft ich als Ärztin erlebt hatte,
daß die wichtigste Frage sich als nachträglicher Einfall
getarnt hatte.
»Nicht viel, Mama. Du weißt, wie er ist. Ich habe ihn
letzte Woche angerufen. Ihm geht es anscheinend gut.«
»Nein, Harri.« Sie wandte sich mir zu. »Ihm ging es
anscheinend nicht gut. Ihm geht es anscheinend nie gut. Du kommst
hierher, und du hältst mich für dumm, und sagst mir, alles
ist in Ordnung. Jedem geht es gut. Aber ich bin nicht dumm, und es
geht nicht jedem gut.«
Sie erschreckte mich. Sie stand mit dem Rücken zur Tür,
die Hand auf dem Knauf. Nur so, dachte ich, fühlte sie sich
sicher genug, um diese Dinge zu sagen.
»Daniel geht’s nicht gut. Du denkst, ich erinnere mich
nicht, aber ich tu’s. Jeden Tag erinnere ich mich daran, wie ich
auf dem Knie deines Vaters gesessen habe, Harri, und du hast auf dem
anderen Knie gesessen, und dein Vater hat Daniel in sein Zimmer
hinaufgeschickt, und ich habe seinen Schmerz gesehen, und ich bin
glücklich gewesen. Das war in unserer Küche. Das ist jetzt
lange her, aber ich bin glücklich gewesen. Er hatte dir
wehgetan, mit dem einen oder anderen, und es machte mich
glücklich zu sehen, daß ihm dafür seinerseits
wehgetan worden war.« Sie lenkte den Blick ab und starrte an mir
vorbei aus dem Fenster und das Meer dahinter. »Daniel
geht’s nicht gut. Niemals. Niemals.«
»Das ist Unsinn, Mama.« Ich war wütend. Ich sah,
wohin sie das führte; es führte sie in Richtung auf ein
allzu großes Schuldgefühl. »Es kann jedem gut
gehen. Hör zu, Mama – es liegt an ihnen. Es liegt wirklich
an ihnen.« Ich glaubte das. Ich glaube es noch immer.
Mamas Blick konzentrierte sich wieder. »Du bist hart, Harri.
Du bist meine Tochter, und ich liebe dich sehr, aber ich muß
das sagen. Du bist hart.« Sie tastete hinter sich umher und
öffnete die Tür. »Ich hoffe, die Äbtissin stimmt
zu, die kleine Anna hier aufzunehmen. Es wird mir gefallen, sie zu
sehen. Und Harriet – wenn du das nächste Mal mit Daniel
sprichst, sag ihm, ich hätte nach ihm gefragt… auf
Wiedersehen, jetzt. Gott segne dich.«
Die Tür schloß sich hinter ihr. Erstaunt warf ich mich
in den Sessel. Wie, zum Teufel, war das denn gekommen? Mama war
völlig meschugge geworden. Natürlich war ich hart. Das
Leben war hart. Verdammt hart.
Ich war nicht erstaunt. Erstaunt war das Wort, das ich wähle,
aber in Wirklichkeit war ich zerstört. Der Wiederaufbau
benötigte seine Zeit.
Bald danach läutete die Glocke des Refektoriums zum Essen.
Ich blieb, wo ich war. Die Novizin kam, um nach mir zu sehen.
Normalerweise hätte ich mich auf das Gespräch mit den
Lehrerinnen gefreut, aber ich sagte ihr, ich sei nicht hungrig.
Weitere Kostenlose Bücher