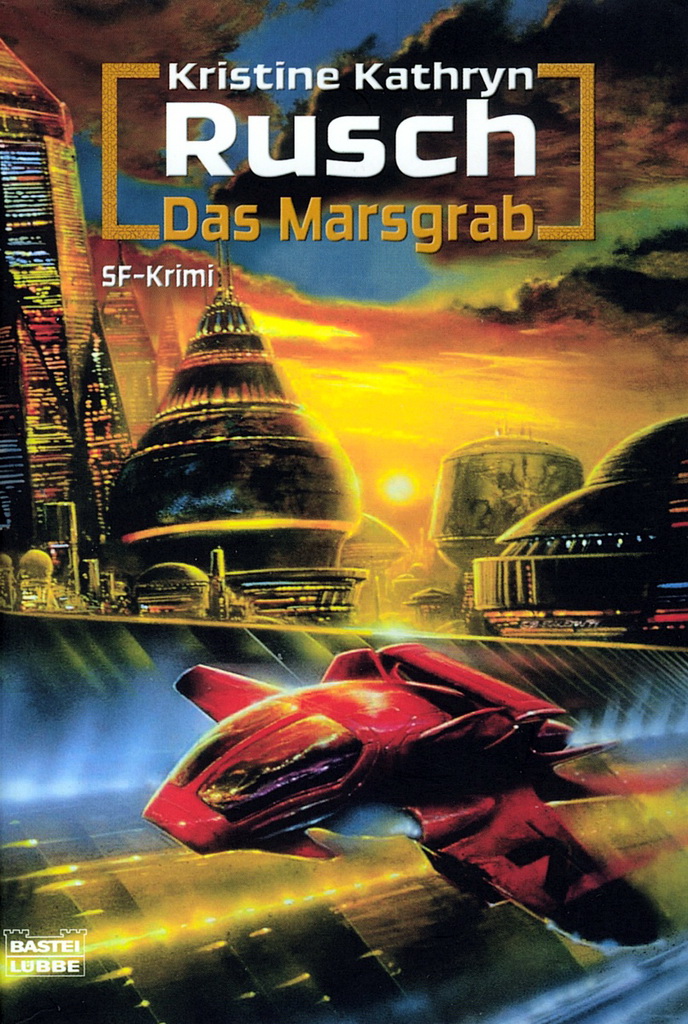![Miles Flint 04 - Das Marsgrab]()
Miles Flint 04 - Das Marsgrab
kaum wahrnehmbar den Kopf. »Nicht gut. Besser als jetzt, aber nicht gut. Sie haben mir nicht zugehört.«
»Ich habe Ihnen zugehört«, widersprach Jefferson. »Und ich höre fundamentale Unterschiede zwischen Ihren und unseren Leuten heraus. Wir glauben, die Aufdeckung eines Problems – das Ans-Licht-Bringen eines Problems – ist der erste Schritt zu dessen Lösung. Sie scheinen das genaue Gegenteil zu glauben, nämlich, Probleme zu offenbaren würde sie schlimmer machen.«
»Noch einmal, Sie sehen die Dinge nur durch das Prisma Ihrer eigenen Erfahrung. Eines Tages, Mr. Jefferson, sollten Sie versuchen, in einer vollständig nichthumanen Umgebung zu leben, und entdecken, welche Perspektive Sie dort gewinnen.
Bis dahin, fürchte ich, sind Sie ein schlechter Fürsprecher für Ihre Leute.«
Nummer Sechsundfünfzig drehte sich wieder zur Tür um und setzte sich in Bewegung.
»Warten Sie!«, sagte Jefferson. »Wollten wir nicht eine Lösung finden?«
Nummer Sechsundfünfzig blieb stehen, sah Jefferson aber nicht an. »Ich glaube, wir haben gerade herausgefunden, dass es keine Lösung gibt, zumindest keine, auf die wir uns einigen können. Wir werden uns selbst um die unsrigen kümmern. Ich schlage vor, Sie tun das Gleiche.«
Und damit ging er.
Jefferson ließ den Kopf sinken. Nie zuvor hatte er so spektakulär versagt – und nie hatte er versagt, wenn so viel auf dem Spiel gestanden hatte.
Die Kluft zwischen Disty und Menschen war gerade unüberwindbar geworden.
49
F lint ging seine komplette Kontaktliste durch. Es gelang ihm nicht, die Generalgouverneurin zu erreichen, den Bürgermeister von Armstrong oder den Repräsentanten Armstrongs im Rat der Vereinten Mondkuppeln. Auch konnte er keinen Kontakt zu einem der Angehörigen des Stadtrats herstellen, und die Polizeichefin reagierte auf seinen Link mit einer spitzen Bemerkung: Sie spreche nicht mit Lokalisierungsspezialisten.
Flint versuchte sogar, die Allianz zu erreichen, wurde aber lediglich eingeladen, eine Botschaft für einen Ausschuss zu hinterlassen und die Antwort abzuwarten, die er »in ein paar Tagen« erhalten würde.
Flint fühlte sich schwindelig und verzweifelt. Im Büro war es wieder heiß geworden. Er würde die Umweltkontrollen neu einstellen müssen – eine Arbeit, der er sich, wie es schien, jeden Monat zu widmen hatte. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
DeRicci hatte er nicht kontaktieren wollen. Er wusste, dass sie mit der Flüchtlingssituation so oder so überfordert sein musste. Aber nun hatte er keine andere Wahl mehr.
Er benutzte ihre Notfalllinks.
Sie antwortete nur Audio: »Hat es Zeit?«
Er hörte den Ärger in ihrem Ton und hätte beinahe gelächelt. Noelle DeRicci stand unter großem Druck und wünschte sich eher weniger als mehr Informationen.
»Nein, Noelle, hat es nicht. Ich habe vielleicht eine Lösung für die Disty-Krise.«
DeRicci fluchte, was nicht die Reaktion war, mit der Flint gerechnet hatte. Dann bat sie ihn zu warten. Von da an schwieg der Link so umfassend, dass Flint seine Funktionstüchtigkeit überprüfte, um sich zu vergewissern, dass der Link nicht tot war.
Dann meldete DeRicci sich zurück, dieses Mal in Ton und Bild, welches Flint auf seinen Hauptschreibtischschirm legte. Eine winzige DeRicci auf einem Gesichtsfeldfenster zu sehen machte ihn nervös.
»Mach schnell!« DeRiccis Gesicht zeigte sich mit schroffer Miene. »Ich rede gerade mit der Generalgouverneurin, und sie ist nicht glücklich darüber, dass ich die Häfen geschlossen habe.«
Offensichtlich hatte DeRicci die Politik übergangen, um ihre Arbeit zu machen. Das wunderte Flint nicht, aber im Moment konnte er sie auch nicht darauf ansprechen. Er kannte diesen Gesichtsausdruck. DeRicci stand so sehr unter Druck, dass sie ihm einfach das Wort abschnitte, sollte sie den Eindruck gewinnen, er vergeude nur ihre Zeit.
»Ich habe eine Anzahl Menschen gefunden, die das Massaker überlebt haben«, sagte er.
»Und?«
»Und«, entgegnete er, »die Disty können sie dazu benutzen, ihre Leute und die Kuppeln zu dekontaminieren.«
DeRicci kniff die Augen zusammen. »Das weiß ich. Warum sollte ich ein Interesse an diesen Überlebenden haben?«
»Weil Dutzende von ihnen auf dem Mond leben.«
Jegliche Farbe schwand aus ihrem Gesicht. Dann öffnete sich ihr Mund ein wenig, und sie schüttelte den Kopf. Sie hatte genau verstanden, was das bedeutete. Es bedeutete, dass es eine Lösung gab. Es bedeutete, die Krise würde
Weitere Kostenlose Bücher