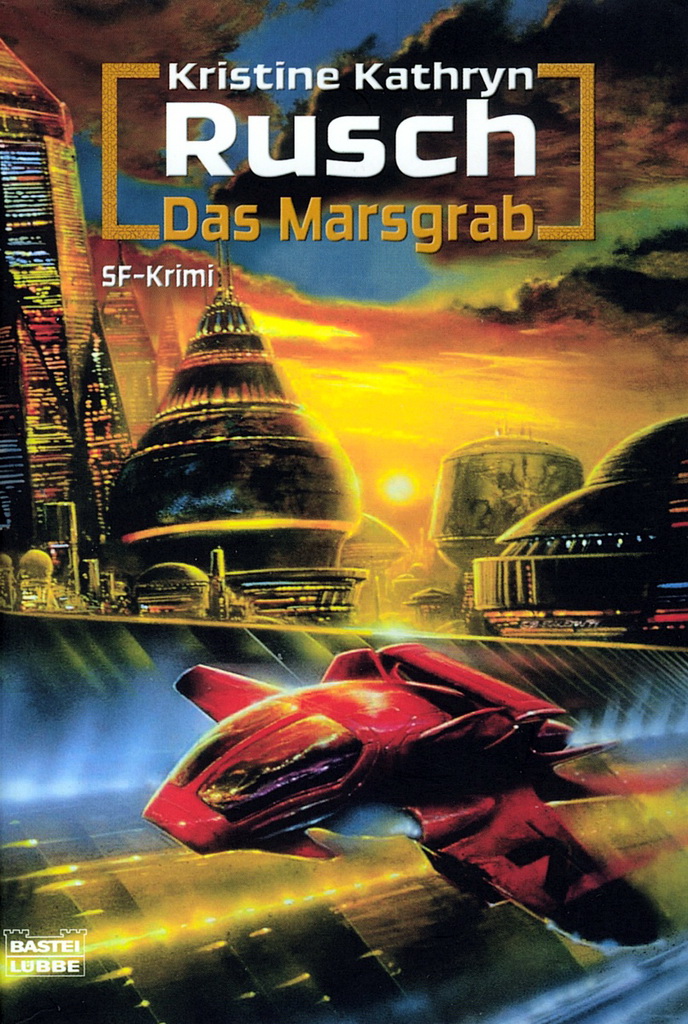![Miles Flint 04 - Das Marsgrab]()
Miles Flint 04 - Das Marsgrab
Angst.«
»Reizend«, kommentierte DeRicci.
Die Generalgouverneurin rief sie über ihre Links. Seufzend ging DeRicci zurück in ihr Büro.
Die Generalgouverneurin benutzte einen Teil des Wandschirms als persönlichen Sichtschirm. Eine Frau, die DeRicci noch nie gesehen hatte, blickte ihr daraus entgegen. In der Ecke kennzeichnete ein Allianzlogo die Transmission.
»Können Sie mir – uns – zusichern, dass diese Namen korrekt sind?«, fragte die Generalgouverneurin.
»Ja«, sagte DeRicci. Sie vertraute Flint. Gäbe es irgendwelche Zweifel wegen der Namen, so hätte er sie nicht kontaktiert.
»Wie sind Sie an die Namen gekommen?«, wollte die Generalgouverneurin wissen.
»Ich habe in dem Moment, in dem ich davon gehört habe, einen Rechercheur darauf angesetzt«, erklärte DeRicci in der Hoffnung, ihre Lüge klinge glaubhaft genug. »Es hat eine Weile gedauert und viel Glück erfordert, aber ich habe die Informationen erhalten.«
Die Frau auf dem Schirm nickte. »Meine Quellen sagen, wir müssen diese Überlebenden in die Saharakuppel bringen. Ich werde mit einem der hiesigen Disty reden und mich nach der Vorgehensweise erkundigen. Sie, Generalgouverneurin, werden die Überlebenden heranschaffen und dafür sorgen, dass sie reisebereit sind.«
»Wird erledigt«, sagte die Generalgouverneurin.
»Ich melde mich in Kürze mit den genauen Anweisungen«, sagte die Frau und meldete sich ab. Das Allianzlogo füllte kurz den Schirm aus. Dann kehrten die Nachrichten zurück, winzige Bilder vom Mars und von noch winzigeren Schiffen, die wie Staub in einem Windsturm von ihm aufstoben.
»Sie haben gehört, was sie gesagt hat«, wandte sich die Generalgouverneurin an DeRicci. »Trommeln Sie diese Leute zusammen!«
»Das ist nicht so einfach«, gab DeRicci zu bedenken. »Diese Menschen leben über den ganzen Mond verteilt. Wir haben keine mondweite Sicherheitsüberwachung, die sich darum kümmern könnte. Wir brauchen die Unterstützung sämtlicher Bürgermeister.«
Die Generalgouverneurin seufzte. »Sie werden uns sicher unterstützen, sobald sie erst begriffen haben, worum es geht.«
»Und«, hakte DeRicci nach, »wenn diese Überlebenden den Mond verlassen sollen, wie bekommen wir sie von hier fort? Die Vereinten Kuppeln haben keine Flotte.«
»Ich nehme an, wir werden ein privates Schiff requirieren müssen«, erwiderte die Generalgouverneurin. »Zuerst einmal bringen wir diese Leute alle nach Armstrong. Von hier aus verlassen sie dann den Mond.«
»Wir haben keine Befugnis zum Requirieren privater Schiffe«, wandte DeRicci ein. »Wir könnten eines anmieten, aber ich fürchte, wir würden damit die Aufmerksamkeit der Medien erregen. Wenn die davon Wind bekommen, werden sie sich alle auf dieses Schiff stürzen, und ich halte es für besser, die ganze Sache geheim zu halten.«
»Einverstanden«, meinte die Generalgouverneurin.
»Außerdem wäre da noch der Pilot, wer immer das sein wird«, fuhr DeRicci fort. »Wir brauchen jemanden, der erfahren ist und unter Druck nicht zusammenklappt.«
»Sehen Sie zu, was Sie in diesem Punkt tun können!«, befahl die Generalgouverneurin barsch. »Ich kümmere mich derweil um die Bürgermeister.«
»Wir brauchen diese Überlebenden so schnell wie möglich«, mahnte DeRicci.
Die Generalgouverneurin musterte sie finster. »Mir ist bewusst, dass dies ein Notfall ist.«
»Gut«, sagte DeRicci. »Denn es kann immer noch alles Mögliche schief gehen.«
51
J efferson trat durch die kleine quadratische Tür und kam sich vor, als würde er einen Kinderspielplatz besuchen. Er war bisher noch nie in der Disty-Sektion des Komplexes gewesen, und er fühlte sich nicht wohl dabei, sie aufzusuchen. Aber Sechsundfünfzig würde nun einmal nicht zu ihm kommen.
Sie würden sich also auf Disty-Terrain treffen.
Jefferson hatte ein Dutzend Nachrichten geschickt, seit er die Information aus Armstrong erhalten hatte, dass dort Überlebende des Massakers ausfindig gemacht worden seien. Ein halbes Dutzend Disty-Experten im menschlichen Diplomatenteam hatte ihm versichert, das sei sicherlich die Lösung des Problems.
Er hingegen war nicht sicher, wieso das so sein sollte. Aber in Zeiten wie diesen war er klug genug, keine Fragen zu stellen.
Er wünschte nur, er wäre klug genug gewesen, in Gegenwart von Sechsundfünfzig überhaupt nicht erst die Geduld zu verlieren.
Nummer Sechsundfünfzig hatte offensichtlich seinerseits die Geduld mit Jefferson verloren. Er hatte keine der
Weitere Kostenlose Bücher