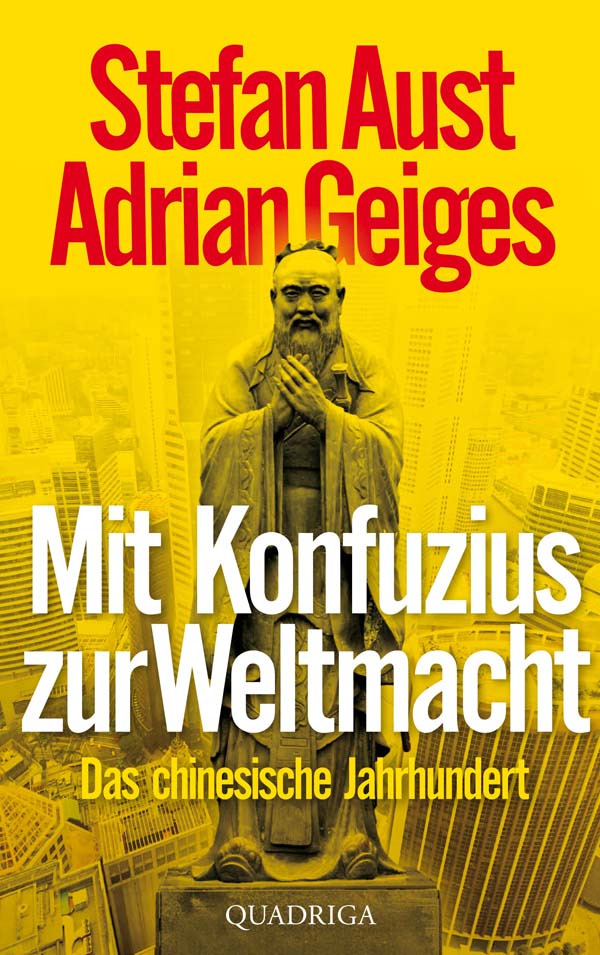![Mit Konfuzius zur Weltmacht]()
Mit Konfuzius zur Weltmacht
einen 76-Millionen-Dollar-Vertrag über weitere fünf Jahre unterschrieben, bei Länderspielen dagegen dribbelte er für seine Heimat. »Das mag ich in den USA: Wenn ich dort jemandem sagte, ich möchte zuerst meinen Bissen runterschlucken, bevor ich ein Autogramm gebe, wird das respektiert. In China ist das leider nicht immer so.« Auch Letzteres ist reichlich untertrieben, denn Yao Ming bedient sich seines trockenen Humors.
Chinesen verbergen ihre Schaulust nicht, bei einem Autounfall oder einer Schlägerei bilden Dutzende Menschen mit verschränkten Armen einen Kreis und glotzen. Würde Yao Ming auf die Straße gehen, wären es Hunderte. Deshalb geht er nicht auf die Straße.
Morgens holte ihn ein Buick GL8 am Apartmentgebäude ab, das er in Peking nutzte, natürlich in einer geschlossenen Anlage für Sportler, Unbefugten war das Betreten verboten. Den Kleinbus zu besteigen ist bei seiner Größe ein Sport für sich, er zieht den Kopf ein, um durch die Schiebetür zu kommen, und krümmt sich zusammen, weil er sonst das Dach durchbohren würde. So wurde er dann zur Basketballhalle der Staatlichen Allgemeinen Sportverwaltung gefahren, einem ebenfalls abgeschotteten Gelände. Sein Tagesablauf sah so aus wie damals fast jeden Tag: Ab 9:30 Uhr lief er eine Stunde auf einem Band, von 10:30 Uhr an lag er auf einer Matte und bewegte seine Beine, der Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Ab 10:50 Uhr kletterte er über Hürden hinüber und kroch darunter durch. Von 11 Uhr an stand Laufen durch die Halle auf dem Plan, bevor er zehn Minuten später auf einem Bein um Kegel herum hüpfte, eine spezielle Übung, weil er sich bei einem Spiel einen Knochen gebrochen hatte.
Yao Ming fand sein eigenes Leben langweilig, und er sagte für einen Spitzensportler ungewöhnliche Dinge: »Es ist nicht meine Natur, hart zu kämpfen.« Oder: »Als Kind spielte ich nicht gern Basketball.« Das zählt aber in China nicht, schließlich sprach Konfuzius: »Im Staate der Obrigkeit, in der Familie dem Vater und dem älteren Bruder dienen!« Diese Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft wurde im sozialistischen China bis ins Extrem betrieben. Yao Ming hat sein Schicksal nicht selbst gewählt, Chinas Regierung hat es entschieden – und zwar schon vor seiner Geburt.
Im Sport hatten die Kommunisten, wie in vielen anderen Belangen auch, lange einen Zickzackkurs verfolgt: Mao noch hatte das Streben nach Medaillen und Trophäen als »konterrevolutionäres Verbrechen« verfolgen lassen, sogar ein Schimpfwort dafür erfunden: »Trophäismus«. Der Tischtennisspieler Rong Guotuan, 1959 noch als Weltmeister gefeiert und knapp zehn Jahre später dieses »Verbrechens« angeklagt, erhängte sich in der Gefängniszelle.
Deng Xiaoping korrigierte diese Politik mehr als geringfügig: Nun sollte das Reich der Mitte bei internationalen Sportwettkämpfen glänzen. Die neue Linie fand ihren Höhepunkt in der im Jahr 2000 von Chinas Staatsrat beschlossenen »Goldmedaillenstrategie«. Intern hieß sie »Plan 119«, benannt nach der Anzahl Goldmedaillen, die in den medaillenstarken Sportarten wie Leichtathletik und Rudern vergeben werden. Um in diesen Sportarten aufzuholen, wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Dabei vereinigte China die Vorzüge des sozialistischen Sportsystems, etwa die Sportschulen, die körperlich gut gebaute und talentierte Kinder und Jugendliche rekrutieren, mit der Scheckbuch-Politik: Aus dem Ausland wurden 20 prominente Trainer engagiert. Die Sportler erhielten umgerechnet 35 000 Euro pro Goldmedaille, mehr als viele Chinesen in einem halben Leben verdienen.
Dabei galt für die chinesischen Sportler: Gold oder gar nichts, Silber und Bronzemedaillen wurden kaum honoriert. Das hatte nichts mit geheimnisvollen chinesischen Mythen zu tun, wie manchmal gemunkelt wurde, sondern war Resultat einer einfachen Rechnung: Bei den vorherigen Olympischen Spielen in Athen hatten die USA insgesamt 102 Medaillen gewonnen und Russland 92, China nur 63 – das aufzuholen schien aussichtslos. Goldmedaillen hatte China 32 gesammelt und damit nur vier weniger als die USA. Hier zu überholen war ein realistisches Ziel – das bei den Spielen in Peking 2008 mehr als erfüllt wurde: China gewann 51 Goldmedaillen und wurde damit die Nummer eins, weit vor den USA mit 36 Goldmedaillen und Russland mit 23.
»Der chinesischen Regierung geht es bei ihrer Sportförderung in erster Linie um die internationale Reputation«, meinte Professor Eike Emrich,
Weitere Kostenlose Bücher