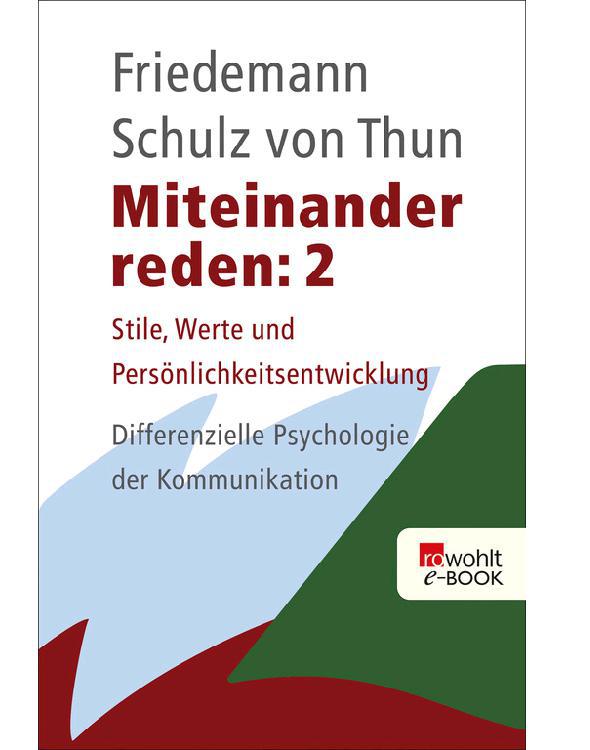![Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung; Differentielle Psychologie der Kommunikation (German Edition)]()
Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung; Differentielle Psychologie der Kommunikation (German Edition)
Unermessliche steigert (siehe Abbildung nächste Seite).
Beide hier beschriebenen Teufelskreise können in ein und derselben Beziehung wirksam werden, zum Beispiel wenn der Partner zunächst fürsorglich reagiert, aber irgendwann, wenn er sich verausgabt hat, in die sich distanzierende Strömung «kippt», dann wieder ein schlechtes Gewissen bekommt usw.
1.3
Richtungen der Persönlichkeitsentwicklung
Der Gestalttherapeut Fritz Perls (1974) hatte Personen mit diesem Kontaktmuster besonders «auf dem Kieker»: Er nenne jeden neurotisch, der seine seelischen Kräfte dazu benutze, andere zu manipulieren, statt selbst erwachsen zu werden. Unfähig, seine eigenen Kräfte anzuwenden, mobilisiere er voller Machtgier Freunde und Verwandte. – Bevor wir aber darangehen, ausgehend von der Gefahr der pathologischen Übertreibung die förderliche Entwicklungsrichtung zu bestimmen, tun wir gut daran, zunächst das Vorhandene zu würdigen und die biografische Leistung darin zu erkennen . Diesen Arbeitsschritt wollen wir uns auch für die folgenden Stile zur Gewohnheit werden lassen. Ich halte ihn insofern für hilfreich, als er uns davor bewahrt, vorschnell und einseitig die «pathologische Brille» aufzusetzen – und das kann sowohl im Umgang mit anderen als auch mit uns selbst nur heilsam sein.
Manch einer könnte bitter nötig etwas von dem gebrauchen, worüber der Bedürftig-Abhängige im Übermaß verfügt – besonders diejenigen, die sich schwertun, andere Menschen um etwas zu bitten oder Hilfe anzunehmen, deren höchste Lebensehre darin besteht, auf niemanden angewiesen und niemandem zu Dank verpflichtet zu sein. Gegen diese meist bindungsängstliche Selbstgenügsamkeit, gegen diese mit zusammengebissenen Zähnen demonstrierte «Ich-brauche-niemanden»-Mentalität ist der Bedürftig-Abhängige gefeit. Sich einzugestehen, dass man alleine nicht mehr weiterkommt und sich dann helfen zu lassen – ja diese Hilfe aktiv zu erbitten: das ist auch eine Fähigkeit . Der gelegentliche Wunsch, sich anzulehnen, beschützt und umsorgt zu werden: dieser Wunsch von Frau und Mann macht Intimität erst möglich und erfüllt menschliche Kontakte mit Sinn. Manche «gestatten» sich diese Strömung nur, wenn sie krank sind – und müssen infolgedessen immer erst daniederliegen, um diesem Teil zu seinem Recht zu verhelfen. Und manche Frauen, die sich auf das Rollenbild des «schwachen Geschlechts» festgelegt sahen, haben im Zuge ihrer Emanzipation zunächst das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: sie versagten sich strikt alle Wünsche nach Abhängigkeit und Versorgtwerden, mit der Folge, dass dieser nicht mehr «linientreue» Teil ihrer inneren Wahrheit in den seelischen Untergrund wanderte und von dort aus für psychosomatische Unruhe oder depressive Stimmungen sorgte (Seyferth und Falt, 1984).
Weiterhin verfügt der Bedürftig-Abhängige über eine Fähigkeit, die andere auch erst noch erlernen müssen: das Jammern ! Wie schlimm alles sei, besonders wenn man alleine davorstehe, und wie schrecklich, wenn alles auf einmal komme, und wie überfordert und hundselend man sich dabei fühle … – Während das «ewige» Jammern die Energien in unfruchtbarer Weise bindet und mit eiserner Entschlossenheit den angeblich so schrecklichen Status quo unverändert lässt, kann das gelegentliche , bewusste Jammern als Entlastungsventil und als seelische Vorstufe neuer Tatkraft dienen.
Eingedenk dieser zu würdigenden Anteile ist nun auch die Frage erlaubt und nötig, wie sich Menschen weiterentwickeln können, die übermäßig häufig oder heftig von der bedürftig-abhängigen Strömung erfasst werden und ihre privaten und/oder Arbeitsbeziehungen entsprechend eingeschränkt gestalten.
Autonomie und Selbstverantwortung. Bei ihnen weist die Kompassnadel in Richtung Autonomie (Eigenständigkeit, Selbstbestimmung) und Selbstverantwortung. Das dazugehörige Entwicklungsquadrat:
Welche Entwicklungsschritte sind auf der Ebene der Kommunikation möglich, um Autonomie und Selbstverantwortung zu fördern? Die Bedürftig-Abhängigen neigen dazu, sich selbst als passiv und abhängig zu erleben, als Opfer des Geschehens. So kommt es auch in ihrer Sprache zum Ausdruck, in der durch Passiv-Konstruktionen und Betonung der Fremdbestimmung die eigene Urheberschaft an den Ereignissen verleugnet wird. Zu erkennen, dass ich es bin, der sich abhängig macht (und in dieses Ziel viel Energie hineinsteckt): Das ist der erste Schritt zu einem erweiterten
Weitere Kostenlose Bücher