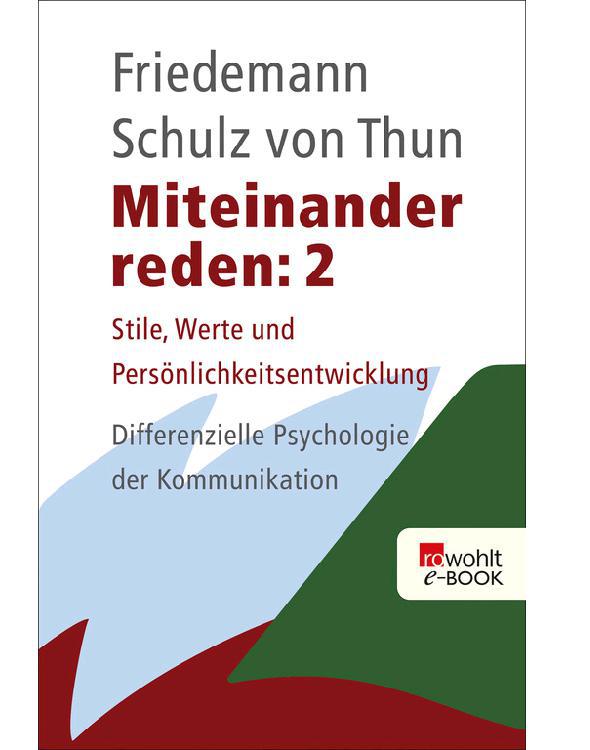![Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung; Differentielle Psychologie der Kommunikation (German Edition)]()
Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung; Differentielle Psychologie der Kommunikation (German Edition)
Bewusstsein. In der Gestalttherapie gibt es mehrere Anleitungen, um die Sprache der Verantwortung zu lernen. So wird der Klient bei jedem
«Ich kann nicht …»
dazu angehalten, den Satz einmal probeweise anders zu formulieren und mit
«Ich will nicht …»
zu beginnen. Zum Beispiel:
«Ich kann keine Knöpfe annähen.»
«Ich will keine Knöpfe annähen.»
«Ich kann ihn doch nicht einfach rausschmeißen.»
«Ich will ihn nicht einfach rausschmeißen.»
«Ich kann dir da auch nicht helfen!»
«Ich will dir dabei nicht helfen.» (Oder: «Ich seh nicht ein, wozu du mich dabei brauchst.»)
Entscheidend ist dabei nicht, dass die veränderte Formulierung möglicherweise besser zutrifft, sondern dass sie ein anderes Gefühl und ein anderes Bewusstsein beim Sprechenden aufkommen lässt. Wenn wir reden, reden wir nicht nur den Adressaten an, sondern immer auch uns selbst etwas ein – darauf hat Neuberger (1985) hingewiesen und für diesen Gedanken unter Verwendung des Nachrichten-Quadrates folgendes Symbol benutzt:
Durch diese Binnenwirkung der Kommunikation gestalten wir uns selbst. Wer fortdauernd bei der Beschreibung von Dingen und Ereignissen seine eigene Fremdbestimmtheit und Passivität hervorhebt, der konserviert und stabilisiert damit sein Lebensgefühl von Abhängigkeit.
Die Sprache der Verantwortung lässt sich auch bei ähnlichen Gelegenheiten lernen. Statt
«Ich muss …»,
wodurch wiederum die Unfreiheit des Handelnden betont wird, kann man alternativ einmal
«Ich entscheide mich für … (bzw. ich will …)»
versuchen (Stevens, 1975, S.12). Zum Beispiel
«Ich muss auf diesen blöden Empfang gehen.»
«Ich entscheide mich dafür, auf diesen Empfang zu gehen, obwohl ich ihn blöde finde.»
«Ich muss früh nach Hause.»
«Ich will früh nach Hause.»
Auch hier gestalte ich mich selbst: Durch «ich muss» mache ich mich zum Sklaven und delegiere die Verantwortung an höhere Mächte; durch «ich will» mache ich mich zum Souverän. In ähnlicher Weise überprüft der Therapeut auch bei anderen Formulierungen: Betont der Klient den eigenverantwortlichen Teil, der seine persönliche Entscheidung im Rahmen seines Handlungsspielraumes ermöglicht? Oder betont er die Umstände, durch die er sich getrieben, gezwungen, veranlasst sieht?
«Ich darf ja abends nicht mal alleine ausgehen!», beklagt sich eine Freundin über ihren streng wachenden Freund. Darf nicht? Ist sie sich bewusst, wie viel Macht sie dem Freund über sich einräumt? Und wie sie ihm die Verantwortung zuschiebt für ihre Entscheidung, seinen Wünschen und Verboten Gehorsam zu leisten? Also:
«Ich darf nicht …»
«Ich habe mich entschieden, den Anweisungen Folge zu leisten!»
«Und dazu stehe ich!» Oder nicht? Vielleicht löst diese Probeformulierung eine Auseinandersetzung mit mir selbst aus, bei der ich mir klar werde, wie sehr ich dazu neige, mich zur Marionette zu machen, um nur nicht Konflikte durchstehen zu müssen, um nur nicht verantwortlich und erwachsen zu werden. In jedem «Ich darf nicht …» halte ich an einem Stück behüteter Kindheit fest – und vielleicht ist dieser (untaugliche) Versuch nur allzu verständlich angesichts eines großen Nachholbedürfnisses an Behütung? Es ist durchaus möglich, dass der bedürftig-abhängige Mensch, bevor er zu neuen Ufern der Eigenständigkeit aufbrechen kann, erst noch in einer Therapie nachholen muss, was früher zu kurz gekommen ist, das heißt erst noch intensiv beschützt und gehalten, umsorgt und gepflegt werden muss.
Eine weitere Übungsrichtung kann für den bedürftig-abhängigen Menschen darin bestehen, schrittweise seinen Stil, um Hilfe zu bitten , zu verändern. Und zwar
spezifisch statt global,
aktiv regieführend statt sich passiv überlassend,
offen und deutlich statt verdeckt und zwischen den Zeilen.
Was mit diesen drei Punkten gemeint ist, sei am Beispiel verdeutlicht. Angenommen, jemand hat ein Problem am Hals, wie zum Beispiel das Wohnungsproblem aus dem Musterdialog (s. S.73f.). Global um Hilfe zu bitten sähe so aus, dem anderen das Problem vor die Füße zu werfen und «Was mach ich bloß?» zu seufzen (das heißt «Fang du mal an, die Sache mit Tatkraft und kühlem Kopf in die Hand zu nehmen – denn ich liege ja am Boden und kann nicht!»). Gleichzeitig überließe er sich dabei passiv der Regie des anderen. Spezifisch und aktiv regieführend wäre hingegen das Hilfeersuchen dann, wenn er sich als zuständiger Problemlöser zeigte und dem
Weitere Kostenlose Bücher