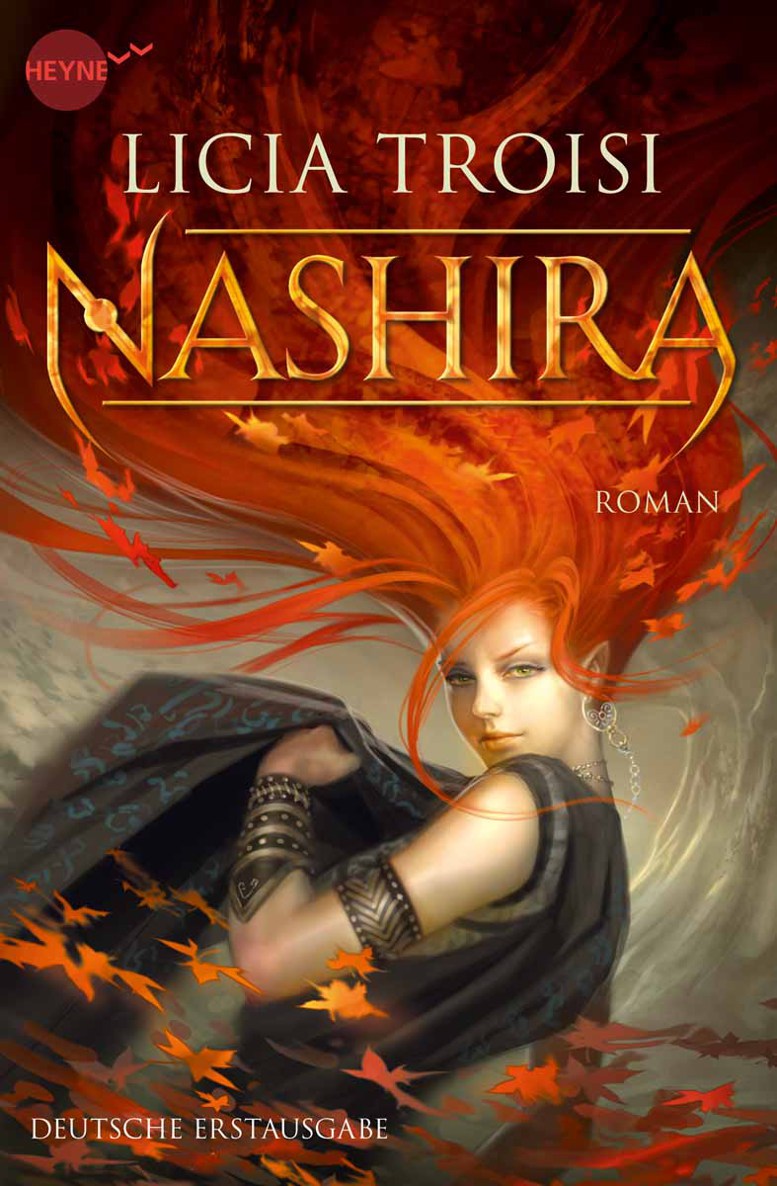![Nashira]()
Nashira
Zukunft unseres Hauses steht auf dem Spiel.«
Talitha schnappte nach Luft. Der von der Trainingsstunde zurückgebliebene Schweiß erkaltete auf ihrem Rücken und erinnerte sie daran, dass sie gerade noch mit dem Schwert in Händen in der Arena gestanden hatte. »Ich bin eine Kadettin, und meine Zukunft liegt bei der Garde.«
»Mach dich nicht lächerlich. Die Tochter eines Grafen kann nicht Gardistin werden.«
»Wieso? Es gibt noch mehr Frauen bei der Garde«, erwiderte sie wütend. Sie wunderte sich selbst über ihre Entschlossenheit: Noch nie im Leben hatte sie ihrem Vater auf diese Weise die Stirn geboten.
»Du bist eine Gräfin. Von denen kann sich keine Einzige mit dir vergleichen«, donnerte Megassa. »Du weißt doch genau, was das für Frauen sind, die in der Garde dienen, einfache Frauen aus dem Volk oder bedauernswerte Geschöpfe aus Familien ohne männliche Nachkommen, die den Waffendienst leisten könnten. Sobald sich eine Möglichkeit ergibt, fliehen sie in die Ehe. Denn Gardist zu sein ist eine niedere Arbeit, bei der man sich die Hände schmutzig macht. Und keine Frau hat es je an den Waffe weit gebracht, weder im Heer noch in der Garde. Nein, ein Schwert zu tragen, ist nicht die Aufgabe, die einer Frau im Leben zukommt. Es kann ein nettes Spiel sein, mehr aber auch nicht.«
Talitha biss sich auf die Lippen und senkte den Kopf. Nicht einmal eine Stunde zuvor hatte sie sich in der Arena noch so stolz gefühlt, so stark und selbstsicher, so frei. »Für mich war das nie nur ein Spiel«, murmelte sie.
»Das ist mir gleich. Ich eröffne dir die Chance, eines der wichtigsten religiösen Ämter des Reichs zu bekleiden. Das kannst du nicht zurückweisen. Deine Schwester ist tot, und dir fällt die Aufgabe zu, sie würdig zu ersetzen.«
»Aber meine Resonanz ist nur ganz schwach«, wandte sie ein.
»Auch das ist mir egal. Begabt genug bist du auf alle Fälle, so wie alle unsere Vorfahren. Außerdem kann sich so etwas entwickeln und gefördert werden. Das werden wir bald wissen. Ich habe bereits mit der Kleinen Mutter darüber gesprochen, und sie ist ohne Weiteres bereit, dich in ihrem Kloster aufzunehmen, auch wenn deine Begabungen nicht an die deiner Schwester herankommen. Darüber hinaus sollst du ja selbst Kleine Mutter werden, und damit sind eher politische Aufgaben verbunden. Dann kommst du gar nicht in die Verlegenheit, die Magie zu praktizieren.«
Langsam verschleierten Tränen Talithas Blick. Doch sie hielt sie zurück und konzentrierte sich auf ihren Atem, holte tief Luft und sah ihren Vater an. »Nein.«
Megassa erstarrte, fassungslos sah er sie an. »Was sagst du da? Was erlaubst du dir? Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, sondern dir einen Entschluss mitgeteilt. Du gehst ins Kloster.«
»Nein, das werde ich nicht«, ließ sich das Mädchen nicht beirren.
»Aber Talitha ...«, murmelte die Gräfin, wobei sie sich zu ihr vorlehnte. Ihre Augen strahlten etwas aus, was Talitha
noch nie bei ihr gesehen hatte, und sie schien vor Angst zu zittern.
Megassa legte eine Hand auf den kleinen Tisch zwischen dem Mädchen und ihrer Mutter. »Deine Weigerung ist ohne Bedeutung.« Seine Stimme bebte vor Zorn.
»Ihr könnt mich nicht gegen meinen Willen ins Kloster schicken«, erwiderte Talitha.
»Es geschieht doch zum Wohle unserer Familie«, mischte sich nun auch die Gräfin mit einer Stimme ein, die mehr einem Blöken glich.
Diese Worte lösten etwas in Talitha aus.
»Nein, es geschieht nur zu seinem Wohl!«, schrie sie und deutete dabei auf ihren Vater. »Es geschah zu seinem Wohl, dass Lebitha ins Kloster ging, und zu seinem Wohl ist alles, was überhaupt in diesem Palast geschieht!«
Megassas Reaktion traf sie völlig unerwartet. Er brüllte – denn nichts anderes war dieses kehlige Knurren wie von einem Tier, das dem Mund ihres Vaters entwich – und packte sie im Nacken. So hob er sie vom Stuhl und schleuderte sie gegen die Wand. Für einen Moment explodierte der Schmerz in Myriaden von Sternen in ihrem Kopf.
»Nein, ich bitte dich!«, flehte die Gräfin.
»Schweig!«, schrie Megassa.
Langsam wurde Talithas Blick wieder klarer, doch der eiserne Griff ihres Vaters nahm ihr die Luft, und ihr Kopf dröhnte vor Schmerz. Aber mehr als der Schmerz war es die Angst, die sie betäubte, Angst, wie sie sie noch nie erlebt hatte. Bis zu diesem Tag hatte ihr Vater nie selbst die Hand gegen sie oder ihre Schwester erhoben. Alle Strafen, die er ihnen auferlegte, hatte er von den Sklaven
Weitere Kostenlose Bücher