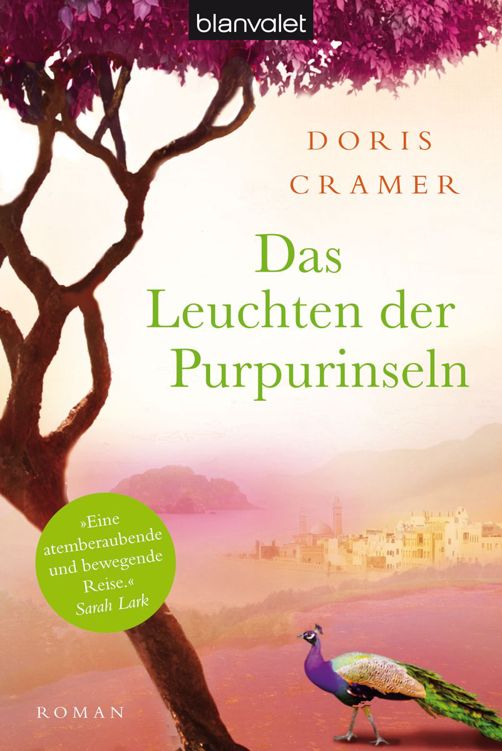![Purpur ist die Freiheit 01 - Das Leuchten der Purpurinseln]()
Purpur ist die Freiheit 01 - Das Leuchten der Purpurinseln
Sache.«
Cornelisz antwortete nicht, eine tiefe Ohnmacht hielt ihn schon längst gnädig umfangen.
Umso besser, dachte Miguel und zog den Verletzten in den Schatten der Uferwand. Hier konnte ihm nichts geschehen. Und mehr konnte er im Moment sowieso nicht für ihn tun. Was er selbst jetzt brauchte, war frisches Wasser, das viele Meerwasser, das er geschluckt hatte, dörrte einen ja förmlich von innen aus! Und dem Jungen ging es wahrscheinlich nicht besser. Vorhin hatte er irgendwo an der Wasserlinie eine von da Palhas leeren Weinflaschen gesichtet, die würde er auf die Suche mitnehmen. Außerdem wollte er sehen, wo die anderen Überlebenden der San Pietro steckten.
Miguel betrachtete die Uferwand und die Klippen, die die Bucht begrenzten. Zehn, höchstens sechzehn Fuß bis oben, schätzte er, das müsste zu schaffen sein. Er sammelte seine Kräfte und begann, über Steine und Felsbrocken nach oben zu klettern. Mehrmals musste er innehalten, um wieder zu Atem zu kommen. Seine Arme und Beine schmerzten, am Rücken hatte er anscheinend eine Prellung, und am liebsten hätte er sich in den Sand gelegt und geschlafen. Der Kampf mit der Brandung hatte seine Kräfte aufgezehrt. Aber er lebte, er hatte es geschafft, dachte er immer wieder, während er seinen Weg über die Felsen suchte.
Was er eigentlich bewerkstelligt hatte, wurde ihm erst klar, als er, oben angekommen, die Bucht überblicken konnte.
Die Strecke zwischen Schiff und Land war nicht besonders weit, steckte jedoch voll unzähliger Hindernisse, die er offenbar mit viel Glück und trotz der stürmischen See überwunden hatte. Wie er jetzt, bei Tageslicht, sah, hatte er Hunderte von schartigen Felsen und Klippen bezwungen, allesamt unter Wasser versteckt, das brausend darüber schäumte und spritzte. Draußen rollte die San Pietro in ihrem letzten Kampf, schon jetzt kaum noch als Schiff erkennbar. Miguel seufzte unwillkürlich, dann ballte er seine Fäuste. » Aber mich hast du nicht gekriegt! Não, nein, mich nicht!«, schleuderte er dem brodelnden Meer von seinem sicheren Ausguck entgegen. Dass er diese schmale Bucht überhaupt gefunden und es bis an den Strand geschafft hatte! Von hier oben kam es ihm fast wie ein Wunder vor.
Außer ihm und dem armen Jungen, diesem Cornelisz, schien allerdings niemand überlebt zu haben, jedenfalls konnte er keine Menschenseele erblicken. Unwillkürlich bekreuzigte er sich und küsste die zusammengelegten Hände.
Dort unten in der Nachbarbucht glitzerte etwas. Miguel kniff die Augen zusammen. Er konnte nicht erkennen, was es war, doch wer im Nichts gestrandet war, konnte alles gebrauchen. Schließlich machte er ein kleines Fass aus, eine Tonne mit zertrümmertem Deckel. Und das Glitzerzeug? Sah beinahe aus wie Gold … Bom Deus, guter Gott, war das möglich?
So rasch er konnte, kletterte er die Uferwand hinab. Ein Fass voller Goldmünzen, das wäre mal ein Strandgut nach seinem Geschmack! Aber wer hatte schon so viel Glück? Er doch gewiss nicht, das wäre ja ein Wunder!
Endlich war er unten angekommen. Wie vermutet, handelte es sich um eines der Rumfässer der San Pietro. Der Stopfen steckte immer noch fest im versiegelten Spundloch, der Deckel der Tonne jedoch lag zersplittert im Sand. Und rundherum im Sand des Spülsaums, zwischen Steinen, Muscheln und Algen, glänzten tatsächlich Münzen, hunderte blanke Münzen. Auf den ersten Blick erkannte Miguel darunter goldene Florin, Gulden aus Flandern , venezianische Dukaten und silberne Taler! Ein richtiger Schatz!
Anscheinend hatten Sturm und Wellen das Fässchen wie anderes Strandgut auch hierhergetragen und es erst zum Schluss an den Felsen zerschlagen. Nun klemmte es zwischen überspülten Steinen und konnte weder vor noch zurück, die Münzen aber lagen verstreut im Sand und wurden allmählich, mit jeder Welle mehr, von Sand bedeckt. Miguel erkannte da Palhas Siegel über dem Stopfen. Hatte der Kapitän eigene Geschäfte abwickeln oder vielleicht ein paar Leute schmieren wollen? Einerlei, für dieses Schiff brauchten keine Rädchen mehr geölt zu werden, niemals mehr. Miguel drehte das Fass herum. Einen Moment stand er wie erstarrt. So viel Gold sah ein Seemann sonst nie auf einem Fleck! Dann machte er sich an die Arbeit.
Er klaubte die Münzen auf und schob sie zu einem Haufen zusammen. Zwischen den Fingern durchsiebte er den Sand, um auch die darin versunkenen Münzen aufzuspüren. Einige fischte er aus einer Pfütze zwischen den Felsen und legte sie ebenfalls
Weitere Kostenlose Bücher