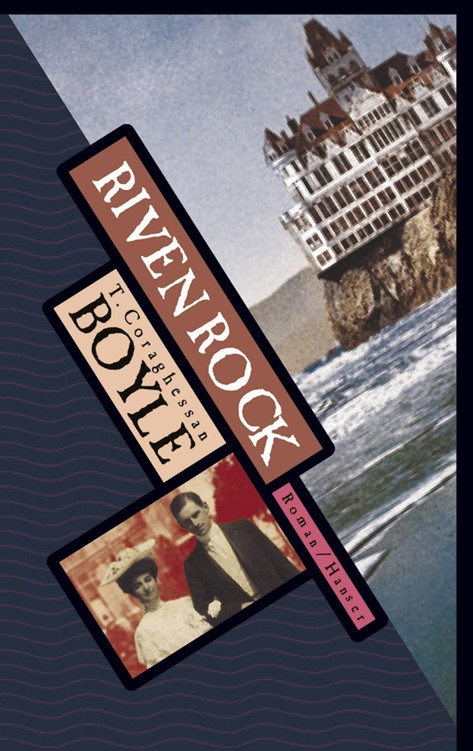![Riven Rock]()
Riven Rock
wäre nicht in diesem Moment Stanley oben an der Treppe erschienen, den Tisch immer noch in den Armen haltend. »Wo sagtest du, soll der hin, Katherine?« rief Stanley, und der Mann sank wieder in sich zusammen, riß die Tür auf und verschwand in die Nacht hinaus.
Offenkundig wurde die Situation allmählich untragbar. Sie konnte sich nichts mehr vormachen: Stanley war zu einer Bedrohung für sich selbst und andere geworden und müßte eigentlich rund um die Uhr beaufsichtigt werden, beaufsichtigt und beschützt. Sie selbst war dazu nicht in der Lage, das wußte sie, deshalb mußte die Scharade ihres häuslichen Zusammenlebens ein Ende finden, einstweilen jedenfalls. Stanley brauchte Hilfe – professionelle Hilfe, institutionelle Hilfe –, und zwar sofort.
Sie konnte ihn an diesem Abend besänftigen, indem sie ihn das gesamte Mobiliar im Salon umstellen ließ, selbst die schwersten Stücke, die er ohne die geringste Anstrengung verschob. Er arbeitete mit jener obsessiven Sorgfalt im Detail, die er jeder Aufgabe entgegenbrachte, rückte jeden Stuhl mal ein Stück hierhin, dann dorthin, immer wieder, bis alles richtig war, doch nach einer Stunde etwa begann er nachzulassen, bewegte sich nur noch mechanisch, bis er schließlich auf ihren Rat hin neben dem Kamin Platz nahm. Das Mädchen servierte ein leichtes Abendessen, und Katherine brachte ihn zu Bett. Als sie eine Stunde später nochmals nach ihm sah, schlief er tief und fest, die Decke bis ans Kinn hochgezogen, sein Gesicht so entspannt und gelassen und wunderschön, als wäre es in Marmor gehauen.
Als ihre Mutter heimkam, erörterten sie gemeinsam bei Keksen und heißem Kakao die Lage. »Oh, ich hab ihn sehr gern gemocht, bevor er sich verändert hat«, sagte Josephine und spitzte die Lippen, während sie einen Keks in ihren Kakao tunkte. »Aber so geht es eben manchmal in der Ehe – sobald sie uns sicher haben, verlieren sie allen Respekt vor uns. Wie er mit mir geredet hat... also, ich hoffe nur, ich muß so etwas nicht noch einmal im Leben hören. Man stelle sich nur vor, daß ich in meinem eigenen Salon ein dummes altes Weib genannt werde – und das vom eigenen Schwiegersohn!«
»Er ist krank, Mutter«, sagte Katherine. »Sehr krank. Er braucht Hilfe.«
»Daran besteht kein Zweifel. Sieh dir nur die Familie an. Seine Schwester. Seine Mutter. Die sind doch alle keine drei Schritte von der Irrenanstalt entfernt, und wenn er so weitermacht, dann muß ich sagen, daß ich deine Ehe mit ihm noch sehr bedauern werde.«
Es war sehr still im Zimmer. Bis auf das Zischen der Kohlen im Kamin und das leise, aber hartnäckige Ticken der Uhr war kein Geräusch zu hören. Katherine umfing die Tasse mit den Händen. Sie dachte an ihre Hochzeitsnacht, an die Szene auf dem Dampfer, an Maine, an Dr. Putnam, Dr. Trudeau und an das krankhaft bleiche, entsetzte Gesicht dieses armen kleinen Deutschlehrers. Dann betrachtete sie ihre Mutter, die Gemälde an den Wänden, die Möbel, die Vorhänge. Da saß sie, die Tochter ihrer Mutter, gut aufgehoben in diesem vertrauten Zimmer, umgeben von den Formen und Farben eines Lebens, das sie bislang geführt hatte, nur jetzt erschien ihr alles verändert, öde und kalt wie eine arktische Landschaft.
»Mama«, sagte sie und fiel damit auf eine Koseform zurück, die sie seit der Kindheit nicht mehr benutzt hatte. »Mama, ich habe Angst vor ihm.«
7
Drei Uhr nachmittags
Als O’Kane die vier Männer in der Seitenstraße hinter Menhoffs Kneipe stehen sah, dachte er sich zunächst gar nichts – dort standen immer Leute, hockten im Dunkeln herum und verbreiteten Halbwahrheiten und glatte Lügen, während sie eine Flasche mit dem Fusel kreisen ließen, den Cody schwarz verhökerte. Er war nicht einmal besonders überrascht, unter ihnen Giovannellas Vater Baldy Dimucci zu erkennen und ihren Bruder Pietro, das Würstchen, mit dem er vor einem halben Leben die kleine Meinungsverschiedenheit auf der Einfahrt von Riven Rock ausgetragen hatte. Pietro war inzwischen Mitte Vierzig, und es war immer noch nicht viel mehr an ihm dran als vor zwanzig Jahren – er war mager wie ein Huhn, nicht so dunkel wie Giovannella, aber mit denselben glänzenden Haaren und unermeßlich tiefen Augen. O’Kane war ihm während all der Jahre oft über den Weg gelaufen – auf der State Street, in Montecito, vor dem Haus der Dimuccis, wenn es regnete und Roscoe Giovannella im Wagen heimbrachte, bevor er ihn und Mart in die Stadt fuhr – und obwohl er nicht hätte
Weitere Kostenlose Bücher