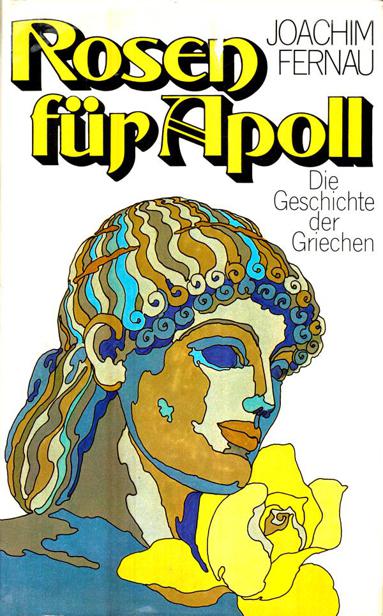![Rosen für Apoll]()
Rosen für Apoll
Spartaner. Sie erhielten freien Abzug und bekamen als Geschenk noch Isagoras drauf.
Kleisthenes und die 700 Planwagen kehrten zurück. Das war im Jahre 508.
Die Erfahrung hatte ihn nun gelehrt, daß es für die Ruhe einer Stadt keine dringlichere Aufgabe gab, als einen Weg zu finden, die Stände-Gruppierung zu zerschlagen. Kleisthenes’ Gedanken kreisten sehr richtig um eine Lösung, die das gesamte Volk neu gliedern sollte, nicht nach Ständen, nicht nach Besitz, nicht nach Wohnorten, denn diese drei Gesichtspunkte schienen ihm unfruchtbar, sie verbanden nicht, sie trennten. Die zu findende neue Gliederung mußte den Zugehörigen einen gemeinsamen Sinn geben. Aber wie?
Da Kleisthenes ein echter Staatsmann war, fand er die Lösung. Er teilte Athen, Binnenland und Küste, also jene drei Gebiete, die schon immer ein Begriff und in so vielen Dingen Gegner gewesen waren, in je zehn Teile. Je ein Zehntel von Athen schloß er jetzt mit einem Zehntel vom Lande und einem Zehntel der Küste zu der Einheit einer »Phyle« zusammen. Das wäre reine Theorie geblieben, wenn er diesen Phylen nicht einen Inhalt gegeben hätte, der einer Interessengemeinschaft über allen Klassenleidenschaften gleichkam. Diese Idee war die große Leistung! Kleisthenes sagte: Nicht mehr eine Ortschaft und nicht mehr ein Stand wird künftig die Regimenter aufbringen, sondern die Phyle. Jede der zehn Phylen (also ein Drittel Athen plus ein Drittel Land plus ein Drittel Küste) hat eine Einheit zu stellen. Sie wählt einen eigenen Kommandeur; die zehn Kommandeure unterstehen direkt dem Polemarchen, dem heerführenden Archonten.
Um uns die Kraft dieses neuen Gedankens, der mehr als ein Gedanke, der ein neues Volksgefühl war, klarzumachen, brauchen wir uns nur daran zu erinnern, wie fest seinerzeit der Weltkrieg 1914/1918 zum erstenmal ein Regiment aus Nürnbergern, Bremern und Breslauern zusammengeschweißt hat.
Aber Kleisthenes legte noch eine zweite Klammer an. Er erhöhte die große Ratsversammlung von den solonischen 400 Sitzen auf 500 und bestimmte, daß es wieder die Phylen sein sollten, die die Mitglieder zu stellen hatten. Kein Zweifel, jetzt begannen die Gedanken der Arbeiter, Bauern, Fischer, Kaufleute, Grundbesitzer, der Künstler, Bankiers und Beamten weit mehr um ihre Phyle zu kreisen als um ihren Stand. Es nützte nun nichts mehr, daß sich die Fischer untereinander verbanden, sie mußten sich mit ihrer Phyle verständigen, das war wichtiger. Bei der Ratsversammlung lamentierten nicht mehr links die Kaufleute, rechts die Grundbesitzer, sondern die Phylen standen beisammen, so wie heute noch in der Schweiz nicht die Parteien beisammenstehen, sondern »die Berner«, »die Unterwaldner«, »die Züricher«. Und bald geschah es, daß man sich in Attika nicht mehr wie früher »Demarchos, Sohn des Lysippos« nannte, sondern seinen Rufnamen mit dem Demosnamen der Phyle verband. Die Phylen hatten herrliche Namen, sie hießen alle nach appetitanregenden athenischen Heroen.
Ein großer und neuer Reiz, sich politisch zu fühlen, lag auch darin, daß in der Zeit zwischen den Versammlungsterminen stets 50 Mitglieder, gewissermaßen als »Nachtdienst«, in Athen anwesend sein sollten. Es traf also jede Phyle einen Monat, und es war natürlich wunderbar für die Leute vom Lande oder von der Küste, 30 Tage in Athen zu sein und sich im Prytaneion, dem »Regierungspalast«, verpflegen zu lassen. Fünfzig Männer unter sich — wer die Südländer kennt, ahnt ihr Wohlgefühl!
Das Erstaunliche an Kleisthenes war nicht das Rechtfinden oder das Sozialordnen, worin er kleiner war als Solon oder Peisistratos, sondern das Erdenken von bisher Undenkbarem, das Aus-der-Luft-Greifen von Ungeahntem, das Erfinden. Er war auch der Erfinder des Ostrakismós, des »Scherbengerichts«, das später eine so große Rolle spielen sollte. Es ist das erste Volksbegehren. Aber worauf richtete es sich! Sie würden nie darauf kommen: Alljährlich wurde der gesamten Volksversammlung die Frage vorgelegt, ob in diesem Jahre ein Scherbengericht abgehalten werden solle; war die Mehrheit dafür, so erhielt jeder eine Tonscherbe, auf die er den Namen desjenigen Mannes kritzeln konnte (nicht mußte), den er für eine Gefährdung, Bedrohung oder Beunruhigung des Staatskurses hielt. Wurden mindestens 6 000 Stimmen abgegeben, so mußte derjenige, der die höchste Stimmzahl erhalten hatte, für zehn Jahre außer Landes gehen; ohne Verlust der Ehre oder seines Besitzes.
Weitere Kostenlose Bücher