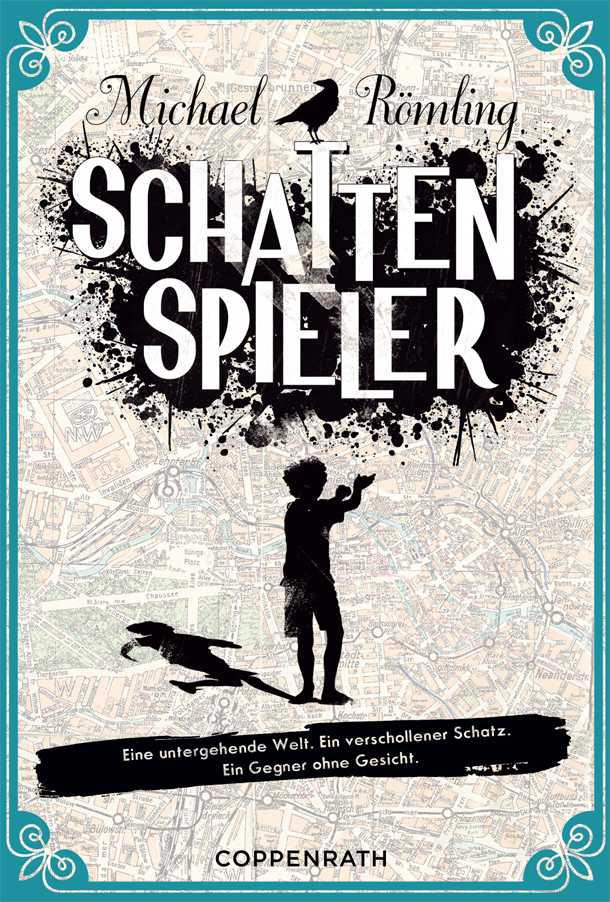![Schattenspieler (German Edition)]()
Schattenspieler (German Edition)
Kettenhunde der Feldgendarmerie überall auf Streife
waren und jeden Passanten einkassierten, der aussah, als könnte
er noch ein Gewehr halten. Aber schließlich hatte das Herumsitzen
ihn fast wahnsinnig gemacht, und er war einfach hinausgegangen,
während seine Mutter beim Metzger war. Dort war
die Schlange noch länger als hier an der Wasserpumpe. Wenn
er Glück hatte, war er vor ihr zurück, und sie merkte gar nichts.
Falls doch, gab es Ärger. Und eigentlich hatte sie ja recht. Aber
der Drang, irgendetwas Sinnvolles zu tun, war einfach zu groß
gewesen. Und jetzt stand er also hier unter den Bäumen am
Rand des Branitzer Platzes in der Wasserschlange.
Friedrich befühlte seine Brusttasche. Es knisterte. Meine Lebensversicherung,
dachte er. Ein Attest. Es bescheinigte Friedrich
Häck, dass er seit einem Bombenangriff im vergangenen
Sommer taub war. Eigentlich eine sichere Sache – wer konnte
schon nachweisen, ob jemand hören konnte oder nicht. Friedrich
hatte diese Rolle auf der Straße längst verinnerlicht. Er
drehte sich nicht um, wenn jemand rief. Und wenn Fremde
ihn ansprachen, lächelte er nur und zuckte mit den Schultern.
Doch je aussichtsloser die Kriegslage wurde, desto gefährlicher
war es, überhaupt nach draußen zu gehen. Die fragen nicht
nach deinem Attest, sagte die Mutter immer wieder. Die stellen
dich einfach als Deserteur an die Wand.
Wieder war vor ihm eine Frau fertig, ließ den Pumpenschwengel
los und trollte sich, den Henkel des randvollen
Blecheimers mit beiden Händen umklammernd. Das Wasser
schwappte ihr auf die Schuhe. Sie achtete nicht darauf. Friedrich
wurde von hinten angerempelt und rückte vor, ohne sich
umzudrehen. Eine Wartende war noch vor ihm.
Auf dem Rasen des Branitzer Platzes, keine zwanzig Meter
entfernt, wurden Volkssturmmänner ausgebildet: Ein Unteroffizier,
kaum älter als Friedrich, erklärte die Bedienung einer
Panzerfaust und zwei Dutzend Rentner hörten teilnahmslos
zu. Unrasierte, eingefallene Gesichter. Kaum Uniformen,
stattdessen löcherige Hosen, die um abgemagerte Beine
schlabberten. Keine Stahlhelme, dafür hier und da ein Hut,
der irgendwann einmal schick gewesen war. Einer trug ein
Gewehr an einem Bindfaden über der Schulter. Ein anderer
stützte sich auf eine Krücke.
Der Unteroffizier hörte jetzt auf zu reden und legte einem
der alten Männer die Panzerfaust auf die Schulter. Der schien
überhaupt nichts verstanden zu haben, fummelte mit zitternden
Fingern an der Zielvorrichtung herum, bis der Ausbilder
die Augen verdrehte, die Waffe wieder an sich nahm und mit
seinen Erklärungen von vorn anfing.
Die Frau vor Friedrich war jetzt fertig und wieder ging ein
träger Ruck durch die Schlange. Friedrich trat auf das kleine
Podest und begann zu pumpen. Aus den Augenwinkeln sah
er, dass der Ausbilder innehielt und zu ihm herüberschaute;
die Volkssturmmänner folgten seinem Blick. Friedrichs Herz
schlug schneller. Ruhig bleiben, sagte er sich, pumpte weiter
und wechselte die Eimer.
Plötzlich näherte sich das scharfe Jaulen eines Jagdflugzeugs.
Die Männer zogen die Köpfe ein und auch die Wasserschlange
geriet in Unruhe. Friedrich zwang sich, völlig ungerührt
weiterzupumpen. Als ein Schatten über ihn hinweghuschte,
blickte er doch auf, einen kurzen Augenblick lang
war das Jaulen ohrenbetäubend. Friedrich sah die Tragflächen
mit den roten Sternen, dann verschwand die Maschine in
einem weiten Bogen in Richtung Berlin-Mitte.
»Die Russen stehen schon in Hohenschönhausen«, sagte
eine Frau hinter Friedrich.
Eine andere Stimme meldete sich von weiter hinten: »Sie
meinen, wir werfen sie gerade aus Hohenschönhausen wieder
raus. Etwas Optimismus, wenn ich bitten darf. Hohenschönhausen
wird unser Stalingrad.«
»Genau«, sagte eine dritte Stimme. »Und nächste Woche
marschiert der Volkssturm in Moskau ein.«
Verhaltenes Gelächter folgte. Friedrich konnte kaum glauben,
was er hörte. Allein der Ton solcher Bemerkungen konnte
lebensgefährlich sein, das wusste jeder. Friedrich schielte zur
Gruppe der Volkssturmmänner hinüber. Der Unteroffizier
hatte offenbar nichts gehört und hielt einem anderen seiner
gebrechlichen Schüler die Panzerfaust hin.
Die Frau hinter Friedrich meldete sich wieder zu Wort;
diesmal versuchte sie, frivol zu klingen: »'n paar schmucke
Jungens ham se noch übersehen, wie's scheint.«
Friedrich spürte, dass er gemeint war. Weiterpumpen, sagte
er sich. Der zweite Eimer war fast voll. Die Frau aber ließ nicht
locker.
Weitere Kostenlose Bücher