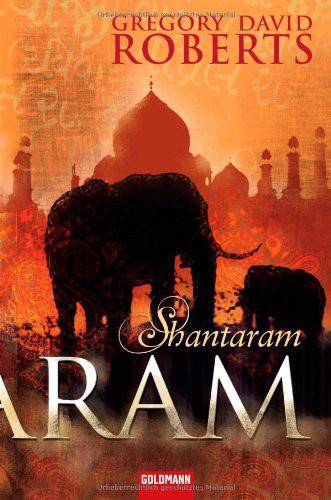![Shantaram]()
Shantaram
Areal war von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben.
Jenseits des Zauns spürte man noch das normale Leben des vorstädtischen Khar, eine Mischung aus Betriebsamkeit und Behaglichkeit: Verkehr und Gärten, Balkone und Basare. Auf dem Eisenbahngelände regierte jedoch die karge Ödnis von Funktion und System. Hier sah man weder Pflanzen noch Tiere und auch keine Menschen. Selbst die rollenden Waggons waren Geisterzüge, die sich ohne Personal oder Passagiere von Rangierhalt zu Rangierhalt bewegten. Und an diesem Ort befand sich der Slum der Leprakranken.
Sie hatten ein rautenförmiges Stück Land zwischen den Gleisen in Besitz genommen und dort ihre Behausungen errichtet, die mir allesamt höchstens bis zur Brust reichten. Aus der Ferne sahen sie aus wie Miniaturzelte eines Militärlagers, umweht vom aufsteigenden Rauch der Kochfeuer. Doch als wir näher kamen, offenbarte sich uns das volle Ausmaß des Elends. Im Vergleich mit diesen Unterkünften waren die Hütten in meinem Slum solide und komfortable Unterkünfte. Diese Behausungen hier bestanden nur aus Pappe und Plastikteilen, zusammengehalten von krummen Ästen und dünner Schnur. Ich hätte das ganze Lager binnen einer Minute mit bloßen Händen dem Erdboden gleichmachen können, und doch lebten hier dreißig Männer, Frauen und Kinder.
Wir betraten den Slum ungehindert und näherten uns einer Hütte in der Mitte. Mehrere Leute blieben stehen und starrten uns an, doch niemand sprach. Es fiel mir schwer, diese Menschen nicht anzuschauen, und wenn ich es tat, war es schwer, nicht zu gaffen. Einige hatten keine Nasen mehr, die Meisten keine Finger; bei vielen waren die Füße mit blutigen Bandagen umwickelt, und bei manchen war der Verfall so weit fortgeschritten, dass ihre Lippen und Ohren fehlten.
Ich weiß nicht, warum – vielleicht ist es der Preis, den die Frauen für ihre Schönheit bezahlen –, doch die Entstellungen wirkten bei den Frauen grauenvoller als bei den Männern. Viele der Männer strahlten etwas Trotziges, beinahe Keckes aus – eine Art aggressiver Hässlichkeit, die faszinierend war. Die Frauen dagegen schienen verschüchtert, und ihr Hunger hatte etwas Raubtierhaftes. Bei vielen Kindern, die ich sah, konnte ich keine Spuren der Krankheit erkennen. Sie schienen gesund zu sein, auch wenn sie zu dünn waren, und sie arbeiteten hart, diese Kinder. Ihre kleinen Finger erledigten alle Handreichungen für die gesamte Sippe.
Sie hatten uns kommen sehen und wohl Bescheid gesagt, denn als wir uns der Hütte näherten, kroch ein Mann heraus und versuchte aufzustehen. Sofort stützten ihn zwei Kinder. Er war sehr klein, reichte mir nur knapp über die Taille, und war von der Krankheit schwer gezeichnet. Seine Lippen und der untere Teil seines Gesichts waren bereits weggefressen, sodass nur noch ein harter, knotiger Strang dunklen Fleisches übrig war, der sich von den Wangenknochen zum Kiefergelenk hinunterzog. Der Kieferknochen selbst lag frei, Zähne und Zahnfleisch ebenso, und statt einer Nase hatte er nur noch zwei klaffende Löcher.
»Abdullah, mein Sohn«, sagte er auf Hindi. »Wie geht es dir? Hast du schon gegessen?«
»Es geht mir gut, Ranjitbhai«, antwortete Abdullah respektvoll. »Ich habe den Gora mitgebracht, damit ihr euch kennen lernt. Gegessen haben wir gerade, danke, aber wir trinken gern einen Tee.«
Ein paar Kinder brachten uns Hocker, und wir ließen uns auf der freien Fläche vor Ranjits Hütte nieder. Sofort bildete sich eine kleine Menschentraube um uns. Die Hinzugekommenen setzten sich auf den Boden oder stellten sich zu uns.
»Das ist Ranjitbhai«, erklärte mir Abdullah auf Hindi, so laut, dass alle es hören konnten. »Er ist der Chef hier, der erste Mann im Slum der Leprakranken. Der König in diesem Club der kala topis.«
Kala topi bedeutet auf Hindi schwarzer Hut, ein Ausdruck, der manchmal als Bezeichnung für Diebe verwendet wird, weil die Diebe im Arthur-Road-Gefängnis von Bombay einen Hut mit schwarzem Band tragen mussten. Ich war mir nicht ganz sicher, was Abdullah mit dieser Bemerkung gemeint hatte, aber Ranjit und die anderen Leprakranken reagierten erfreut, lächelten und wiederholten den Ausdruck mehrmals.
»Sei gegrüßt, Ranjitbhai«, sagte ich auf Hindi. »Ich heiße Lin.«
» Aap doctor hain? «, fragte er. Bist du Arzt?
»Nein!«, antwortete ich abrupt; ich war verstört über die Krankheit und mein mangelndes Wissen und befürchtete, er könne mich bitten, ihnen zu helfen. Ich wandte mich zu
Weitere Kostenlose Bücher