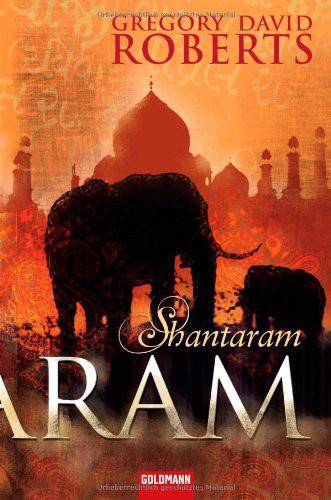![Shantaram]()
Shantaram
gesamten Kinderkörper zu treffen schienen, wenn er zuschlug. Ich hatte Angst vor ihm und schämte mich wegen meines schulischen Versagens. Deshalb habe ich sehr oft geschwänzt und bin, wie man so schön sagt, in schlechte Gesellschaft geraten. Ich habe immer wieder vor Gericht gestanden, und noch vor meinem dreizehnten Geburtstag saß ich zwei Jahre im Kindergefängnis ab. Und mit sechzehn ließ ich das dann alles hinter mir: das Haus meines Vaters, die Stadt meines Vaters und das Land meines Vaters. Für immer.
Durch Zufall bin ich in Genua gelandet. Warst du schon mal da? Ich kann dir sagen, diese Stadt ist das Juwel auf dem Diadem der Ligurischen Küste. In Genua am Strand lernte ich eines Tages den Mann kennen, der mich für alles Gute und Schöne auf dieser Welt empfänglich gemacht hat. Er hieß Rinaldo. Er war damals achtundvierzig – und ich, wie gesagt, sechzehn. Seine Familie hatte irgendeinen Adelstitel. Es war ein uraltes Geschlecht, das bis in Kolumbus’ Zeiten zurückreichte. Aber er lebte ohne den üblichen Standesdünkel in seinem prächtigen Haus an der Steilküste. Er war ein Gelehrter, der einzige wirkliche Renaissance-Mensch, dem ich je begegnet bin. Er hat mich in die Geheimnisse der Antike, die Kunstgeschichte, die Musik der Poesie und die Poesie der Musik eingeführt. Und er war ein schöner Mann. Sein Haar war silbrigweiß wie der Mond, und seine tieftraurigen Augen waren grau. Im Gegensatz zu den rohen, kalten Händen meines Vaters waren Rinaldos Hände lang, schlank, warm und ausdrucksvoll, und sie erfüllten alles, was sie berührten, mit Zärtlichkeit. Ich lernte, was es heißt, mit ganzer Seele und ganzem Körper zu lieben, und in seinen Armen wurde ich erst wirklich geboren.«
Er begann zu husten. Und so sehr er auch versuchte, die Kehle freizubekommen – der Husten entwickelte sich zu einem quälenden Anfall, der ihn am ganzen Körper schüttelte.
»Du musst aufhören, so viel zu rauchen und zu trinken, Didier. Und du solltest dich ab und zu mal ein bisschen bewegen.«
»Oh bitte !«, stieß Didier erschauernd hervor, drückte seine Zigarette aus und fischte sofort eine neue aus dem Päckchen auf dem Tisch. Sein Husten legte sich langsam. »Es gibt nichts Deprimierenderes als gute Ratschläge, und ich wäre wirklich froh, wenn du mich nicht damit behelligen würdest. Ehrlich gesagt, schockierst du mich richtig. Du weißt das doch bestimmt, oder? Ich meine, vor ein paar Jahren hat mir jemand einen derart empörend überflüssigen Rat gegeben, dass ich ein halbes Jahr lang Depressionen hatte. Das war knapp damals – ich habe mich fast nicht mehr davon erholt.«
»Tut mir leid«, sagte ich lächelnd. »Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist.«
»Ich verzeihe dir«, erwiderte er naserümpfend und kippte seinen Whisky hinunter, während der Kellner bereits das nächste Glas brachte.
»Weißt du«, gab ich zu bedenken, »Karla behauptet, dass nur diejenigen depressiv werden, die nicht traurig sein können.«
»Tja, da liegt sie falsch!«, erklärte Didier. »Ich bin Experte auf diesem Gebiet. Die tristesse ist die eigentliche, die maßgebliche Leistung des Menschen. Es gibt viele Lebewesen, die ihr Glück zeigen können, aber nur der Mensch besitzt die Gabe, einer großartigen Traurigkeit Ausdruck zu verleihen. Für mich ist die Traurigkeit etwas ganz Besonderes, eine Art täglicher Meditation. Und die einzige Kunst, die ich beherrsche.«
Er schmollte einen Moment und schien zu verstimmt, um weiterzureden, doch dann blickte er zu mir auf und lachte schallend.
»Hast du von ihr gehört?«, fragte er.
»Nein.«
»Aber du weißt, wo sie ist?«
»Nein.«
»Ist sie nicht mehr in Goa?«
»Ich kenne dort einen Typ, Dashrant, der hat ein Restaurant an dem Strand, wo sie wohnte. Den habe ich gebeten, ein Auge auf sie zu haben und dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Letzte Woche habe ich ihn angerufen, und er sagte mir, sie sei nicht mehr da. Er hat versucht, sie zum Bleiben zu überreden, aber sie … na ja, du weißt ja.«
Didier schürzte die Lippen und blickte nachdenklich. Beide betrachteten wir sinnend das Gewusel und Getrödel, Geschiebe und Gehetze auf der Straße vor den offenen Eingängen des Leopold’s, nur zwei Meter von uns entfernt.
»Eh bien, mach dir keine Sorgen um Karla«, sagte Didier schließlich. »Für ihren Schutz ist schon gesorgt.«
Ich nahm an, dass er damit entweder sagen wollte, Karla sei imstande, auf sich selbst aufzupassen, oder aber,
Weitere Kostenlose Bücher