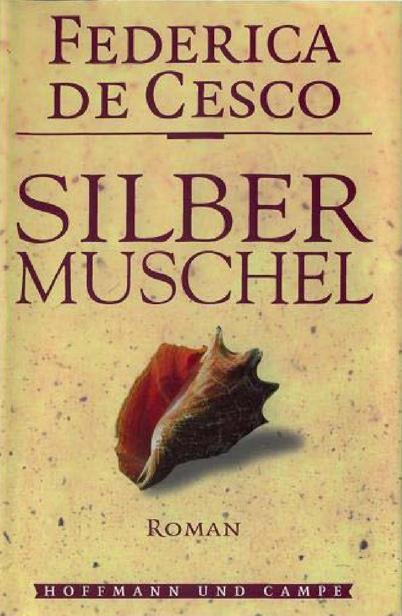![Silbermuschel]()
Silbermuschel
noch? Daneben entdeckte ich in Midori eine Kleinlichkeit und Habgier, die mich betroffen machte, da es sie in meiner Familie nie gegeben hatte.
Midori gehörte einer Klasse von Leuten an, die gern zeigen, wie weit sie es gebracht haben. Sie maß ihren Lebensstandard an dem der Nachbarn; Perlenschmuck, ebenso diskret wie luxuriös, die exklusive Etikette eines Kleides oder Seidenschals, teure Kindersachen für Norio waren in ihren Augen Symbole materiellen Erfolgs, die zum Ansehen der Familie beitrugen. Oft hatte ich den Eindruck, sie dachte immerzu nur daran, wie sie irgend etwas bekommen könnte, was sie noch nicht hatte. Ich jedoch lief zu Hause in abgeschabten Jeans herum, ließ meine ausgetretenen Turnschuhe vor der Haustür stehen und lachte über ihr Geltungsbedürfnis; da sie nicht viel Humor hatte, war sie schnell beleidigt. Dazu hatte ich etwas an mir, was sie mißbilligte: einen Hang zur Ungebundenheit, zu intensiven Gefühlen. Saß ich da, hinter meiner Zeitung, sah es wie Langeweile oder Müdigkeit aus. In Wirklichkeit war ich wie ein verankertes Schiff, an dem die Wellen zerren, bis es sich losreißt und auf dem Wasser treibt. Das machte ihr Angst, logischerweise. Sie hoffte, daß sie mich beruhigte, wenn sie gelassen blieb, meine Unrast beschwichtigte. Sie glaubte an die Macht der Gewohnheit. Und gerade dadurch verloren wir uns aus den Augen. Die angestauten Gefühle brannten in meiner Brust; ich bemühte mich mit aller Anstrengung, meiner Empfindungen Herr zu werden, doch vergeblich. Ohne daß ich es wollte, war ich zu sehr immer nur mit mir selbst beschäftigt: Durch die Straßen irren unter dem Neonlicht.
Nudeln in einer Soba-Bude schlürfen. Eine Bar aufsuchen, dann eine andere. Einer mittelmäßigen Jazzband zuhören. Pachinko spielen wie der letzte Idiot, zwei Stück parfümierte Seife und einen blauen Teddybär gewinnen. Sich eine schwachsinnige Pornoshow ansehen. Dreißig Minuten Überdruß, keine Selbstachtung mehr und Kopfschmerzen wegen der schlechten Luft. Und dann ein anderer Platz, eine andere Straße, eine andere Bar. Und dann zum Bahnhof. Gänge, Rolltreppen, Hallen. Ein Niemandsland, erfüllt vom Echo der Schritte. Vorbeihuschende 383
Gesichter, Leute, die mich anstießen, gleichgültige Blicke, klopfende Absätze, treppauf, treppab. Es ging also wieder los. Wo sollte das enden?
Und dann, eines Abends, geschah etwas. Ich wanderte durch das Vergnügungsviertel Shibuya, ließ mich von dem Menschen ström tragen, ging ziellos an Bars, Cafés, Discos und Jazzkneipen vorbei. Plötzlich blieb ich vor dem Schaukasten eines kleinen Underground-Theaters stehen. Das Theater nannte sich Jean-Jean und befand sich im Untergeschoß einer Kirche. Die skurrile Zweckentfremdung, der französische Name noch dazu amüsierten mich. Die Vorstellung begann in zehn Minuten, und das Programm kündigte eine Solo-Tänzerin an. Das ausgestellte Foto zeigte eine weißgeschminkte Frau, schemenhaft unter einem Scheinwerfer sichtbar. Ich kaufte eine Karte, stieg eine düstere Treppe hinunter und kam in einen kleinen, ganz in Schwarz gehaltenen Raum. Einige Stuhlreihen standen um eine kleine, ebenfalls schwarze Bühne. Auf dem Boden waren Salzkörner gestreut, um die bösen Geister zu bannen und die Bühne zu einem heiligen Ort zu machen. Das gefiel mir. Inzwischen füllte sich der Raum.
Das Publikum bestand aus Leuten aus dem Theatermilieu oder der Modeszene, alle auffällig exzentrisch. Ein paar Ausländer waren auch da. Keine Amerikaner; ich hörte, daß sie französisch sprachen. Allmählich erlosch das spärliche Licht. In der Dunkelheit quietschten noch einige Stühle, dann trat Stille ein. Als ein einzelner Scheinwerfer aufflammte, saß eine Tänzerin zusammengekauert auf der Bühne.
Die meisten Japaner wissen über das Phänomen des Ankoku Butoh, des Tanzes der Finsternis, kaum oder überhaupt nicht Bescheid. Mir ging es nicht anders. In Japan, wo die Künstlerszene mit snobistischer Vorliebe Konventionen pflegt, gilt diese Tanzform der Improvisation, die den Künstler als Medium seiner Innenwelt in den Mittelpunkt stellt, auch heute noch als etwas sehr Befremdendes. Doch beim Anblick dieser Frau war es mir, als ob die Feder eines Nachtvogels meinen Nacken streifte, und ich dachte: Was ist das? Außer einem weißen Lendenschurz war die Tänzerin völlig nackt. Sie war klein, kräftig, muskulös, von Kopf bis Fuß weiß geschminkt. Auch ihre Augenbrauen waren weiß gepudert, die Lippen dunkelrot
Weitere Kostenlose Bücher