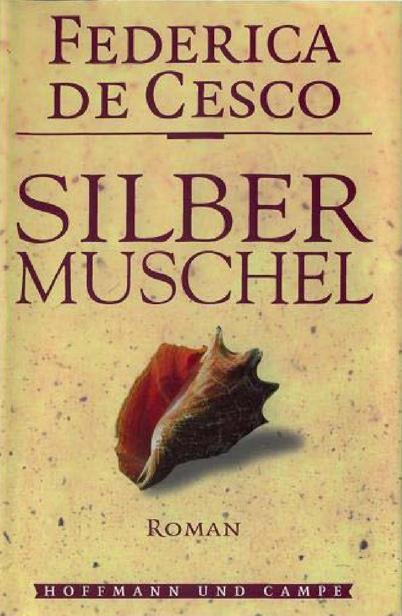![Silbermuschel]()
Silbermuschel
Willen durch. Ich weiß noch genau, wann ich das letzte Mal geweint hatte: Es war im Gefängnis gewesen, als ich die Briefe meiner Mutter an meinen verstorbenen Vater las. In der Nacht, da Norio geboren wurde, ein süßes Baby, stark und gesund, da liefen mir die Tränen über die Wangen, Tränen der Erleichterung und auch des Schmerzes, denn sie betrafen Isami. Aber darüber sprachen wir niemals, auch später nicht; wir verstanden uns ohne Worte, und jeder spürte die Seele des anderen.
Wie die meisten japanischen Männer bin ich ganz vernarrt in Kinder; aber bei uns wird es meist stillschweigend hingenommen, daß die Kinder in erster Linie der Mutter gehören. Ich jedoch hatte stets das Gefühl, daß ich ein ebenso starkes und innerliches Recht auf meinen kleinen Sohn wie Midori hatte. Sobald Norio mich von anderen unterscheiden konnte, brachte ich ihm Spielzeug mit. Und kaum, daß er sich auf seinen Beinchen halten und die ersten Worte stammeln konnte, kam ich so früh wie möglich nach Hause, um bei ihm zu sein. Ich brachte meistens meine freie Zeit damit zu, daß ich mit ihm spielte, ihn herumtrug und mit ihm spazierenging. Ich liebte Norio mit einer Überschwenglichkeit, die Midori offenbar mißfiel. Sie meinte, daß ich das Kind verzog. Norio tollte oft mit mir noch zu einer Stunde herum, zu der andere Kinder längst schliefen. Das widersprach Midoris Erziehungsgrundsätzen, und unsere Meinungsverschiedenheiten, am Anfang nur sehr sporadisch, häuften sich. Im Lauf der Zeit entwickelte Midori immer mehr die typische Eigenschaft der japanischen Mütter, die nur die Ausbildung ihres Kindes im Kopf haben. Als Norio drei Jahre alt war, beschäftigten wir uns stundenlang mit der Wahl eines geeigneten Privatkindergartens – es kam natürlich nur einer der 380
besten und teuersten in Frage. Midori nahm mit Elternabenden, Ausflugbegleitung und Festvorbereitungen sehr aktiv und sehr zeitaufwendig am Kindergartenleben teil. Der Großteil unserer Diskussionen kreiste um Erziehung. Midori war nicht nur ehrgeizig, was Norios Ausbildung betraf; sie erwartete von mir, daß ich meine Stellung verbesserte und unsere Kommunikationsstörungen mit materieller Großzügigkeit behob. Wie die meisten japanischen Hausfrauen verwaltete sie unser gemeinsames Konto, plante äußerst sachverständig das Familienbudget und teilte mir jeden Morgen mein Taschengeld zu.
Inzwischen hatte ich genug Startkapital, um eine eigene Firma zu gründen.
Doch jetzt, wo ich über die finanziellen Mittel verfügte, schob ich meinen Entschluß von einem Monat zum anderen hinaus. Ich fragte mich plötzlich, ob die Welt der Technologie das Richtige für mich war. Ich hatte mit Computern gespielt, wie ein Kind sich mit einem neuen Spiel befaßt und sich von ihm abwendet, sobald es ihn langweilt. Ich war ziemlich tief in das Gebiet vorgestoßen und hatte im Verlauf meiner Tätigkeit sogar eine neue Programmiersprache erfunden. Der Umgang mit der Technologie hatte meine Gesamtwahrnehmung verschärft. Mein Interesse galt nunmehr einem Experimentierfeld, das die Metaphysik mit einbezog.
Ich befaßte mich immer enger mit dem Wesen und den Funktionsmechanismen des Geistes. Aber wollte ich diesen Ideen nachgehen, mußte ich eigene Wege einschlagen.
Mit Midori konnte ich über diese Dinge nicht sprechen. Fragen aufwerfen?
Utopien verfolgen? Irgendein Risiko eingehen? Bloß nicht! Sie wollte, daß ich mich als Aktionär an dem Unternehmen beteiligte, mich beharrlich nach oben schob. Sie nannte das ›dem hierarchischen Weg folgen‹. Ich sollte mich nach konformen Spielregeln verhalten, angestauten Ärger an einem Punching-Ball abreagieren und meinen Hintern nach angemessener Frist in einen Chefsessel plazieren. Unsere vielzitierte Gruppenharmonie verlangt vom einzelnen, daß er alles, oder zumindest den größten Teil, schluckt. Es kann eine Art von Bequemlichkeit werden, die wir nicht tadeln sollten. Sie entspricht auch nicht unbedingt der japanischen Eigenart. Wir alle brauchen sie, die Bestätigung durch andere Menschen. Wir scheuen die Ungewißheit, unser Bedürfnis nach Sicherheit ist groß, das Wort persönliche Freiheit ein dehnbarer Begriff. Nicht alle – im Grunde genommen nur die wenigsten – haben den Wunsch und die Kraft, der sozialen Geborgenheit den Rücken zu kehren. Und es muß ja auch nicht sein, wenn man in seinem Rahmen zufrieden ist. Ich war es nicht: kein bißchen. Ich rebellierte gegen diese Funktion, in die ich gedrängt wurde, in
Weitere Kostenlose Bücher