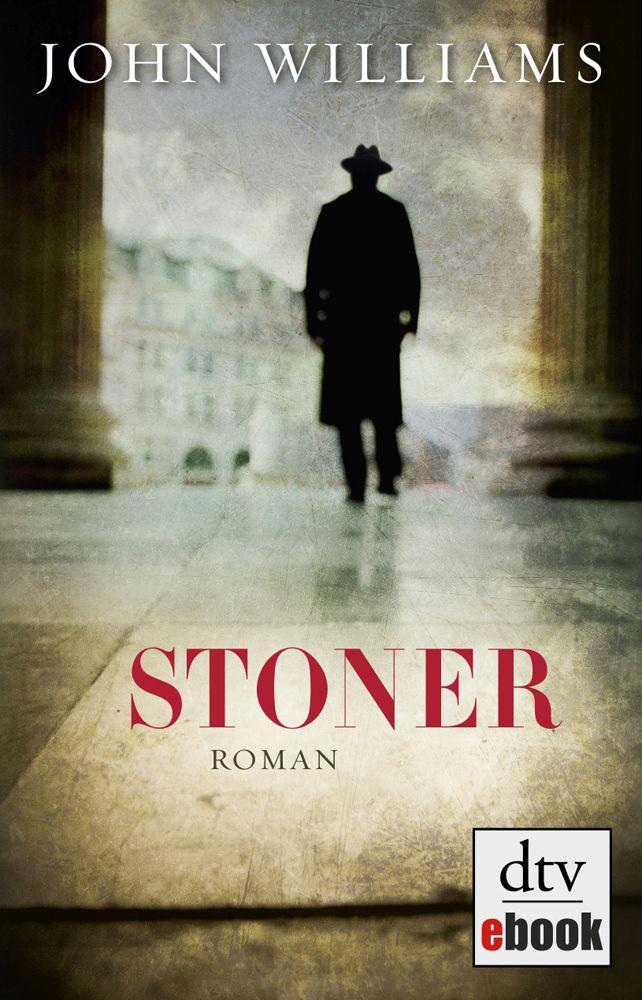![Stoner: Roman (German Edition)]()
Stoner: Roman (German Edition)
etwas aus, wenn ich im Drugstore anrufe, um mir eine Flasche bringen zu lassen?«
»Natürlich nicht«, sagte Stoner. »Nur haben deine Mutter und ich gewöhnlich kein …«
Aber sie war schon aufgestanden und ins Wohnzimmer gegangen, blätterte im Telefonbuch und begann hektisch zu wählen. Als sie in die Küche zurückkam, ging sie an den Schrank, holte die halbvolle Flasche Sherry heraus, nahm sich ein Glas vom Abtropfbrett und füllte es fast bis zum Rand mit dem hellbraunen Wein. Noch im Stehen leerte sie das Glas, wischte sich über die Lippen und schauderte. »Er ist sauer geworden«, sagte sie. »Und ich hasse Sherry.«
Sie trug Flasche und Glas zum Tisch, setzte sich, stellte beides akkurat vor sich hin, goss sich das Glas halbvoll und blickte ihren Vater mit einem seltsamen, verstohlenen Lächeln an.
»Ich trinke ein wenig mehr, als gut für mich ist«, sagte sie. »Armer Vater. Das hast du nicht gewusst, wie?«
»Nein«, sagte er.
»Jede Woche sage ich mir, nächste Woche trinke ich nicht so viel, aber ich trinke immer ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, warum.«
»Bist du unglücklich?«, fragte Stoner.
»Nein«, erwiderte sie. »Ich glaube sogar, ich bin glücklich. Zumindest fast glücklich. Das ist es nicht. Es ist …« Sie ließ den Satz unbeendet.
Als sie den Sherry ausgetrunken hatte, kam der Lieferjunge vom Drugstore mit ihrem Whisky. Sie brachte die Flasche in die Küche, öffnete sie mit routinierten Bewegungen und goss sich einen kräftigen Schuss ins Sherryglas.
Sie blieben auf, bis das erste Grau über die Fenster kroch. Grace nahm immer wieder einen kleinen Schluck, und je weiter die Nacht voranschritt, desto mehr glätteten sich die Falten in ihrem Gesicht; sie wurde ruhiger und jünger, und die beiden redeten miteinander wie schon seit Jahren nicht mehr.
»Ich glaube«, erzählte sie, »ich glaube, ich bin absichtlich schwanger geworden, auch wenn ich es damals nicht begriffen habe; ich fürchte, ich habe nicht einmal gewusst, wie sehr ich unbedingt von hier fort wollte. Dabei wusste ich weiß Gott genug, um nicht schwanger zu werden, wenn ich es nicht gewollt hätte. All die Jungen in der Highschool und« – sie musterte ihren Vater mit einem schiefen Lächeln – »du und Mama, ihr habt nichts davon gewusst, oder?«
»Ich glaube nicht«, sagte er.
»Mama wollte, dass ich beliebt bin, und – na ja, ich war durchaus beliebt. Es war nicht weiter wichtig, überhaupt nicht wichtig.«
»Ich habe gewusst, wie unglücklich du warst«, brachte Stoner mit Mühe über die Lippen, »aber nicht geahnt … nicht gewusst …«
»Ich glaube, ich auch nicht«, sagte sie. »Wie denn auch? Armer Ed. Er ist bei alldem am schlechtesten weggekommen. Weißt du, ich habe ihn benutzt. Na ja, er war durchausder Vater, aber ich habe ihn trotzdem benutzt. Ein netter Junge, und er hat sich immer so geschämt – er konnte es einfach nicht ertragen. Deshalb hat er sich auch sechs Monate früher zur Armee gemeldet, als er eigentlich musste, bloß um wegzukommen. Ich fürchte, ich habe ihn auf dem Gewissen; er war so ein lieber Junge, dabei haben wir uns nicht einmal besonders gemocht.«
Sie unterhielten sich bis zum Morgengrauen, als wären sie alte Freunde. Und Stoner sah ein, dass sie, ganz, wie sie behauptet hatte, in ihrer Verzweiflung beinahe glücklich war; sie würde ihr Leben ruhig zu Ende leben, würde ein wenig mehr trinken, Jahr um Jahr, und sich gegen das Nichts betäuben, zu dem ihr Leben geworden war. Er war froh, dass sie wenigstens das hatte, dankbar dafür, dass sie trinken konnte.
*
Die Jahre, die unmittelbar auf das Ende des Zweiten Weltkriegs folgten, waren seine besten Jahre an der Universität und in mancher Hinsicht die glücklichsten Jahre seines Lebens. Die Kriegsveteranen kehrten zurück und veränderten das Leben auf dem Campus, brachten eine Qualität mit, die es vorher nicht gegeben hatte, eine Intensität und einen Trubel, die zu einer wahrhaften Verwandlung führten. Er arbeitete wie nie zuvor; die ihm eigenartig erwachsen scheinenden Studenten waren ungeheuer ernst und verachteten alles Triviale. Mode oder Brauch interessierten sie nicht, und sie gingen ihre Studien an, wie Stoner es sich einmal von seinen Studenten erträumt hatte – als wäre ihr Studium das Leben selbst und nicht Mittel zum Zweck. Er wusste, nach diesenwenigen Jahren würde das Unterrichten nie wieder dasselbe sein, und er überließ sich einem glückseligen Zustand der Erschöpfung, von dem er
Weitere Kostenlose Bücher