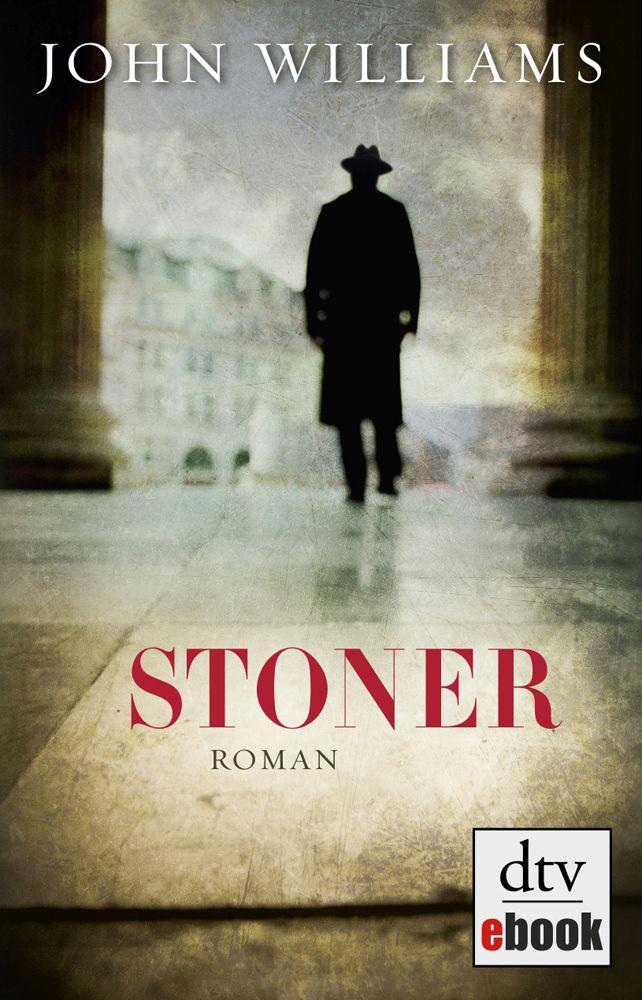![Stoner: Roman (German Edition)]()
Stoner: Roman (German Edition)
ein liebenswertes Kind, das schon vor Langem gestorben war.
Zwei Monate nach der Heirat meldete sich Edward Frye zur Armee, und Grace beschloss, bis zur Geburt des Kindes in St. Louis zu bleiben. Keine sechs Monate später lag Fryetot auf dem Strand einer kleinen Insel im Pazifik, einer von vielen Rekruten, die man in dem verzweifelten Versuch ausgesandt hatte, den Vormarsch der Japaner aufzuhalten. Im Juni 1942 wurde Grace’ Kind geboren; es war ein Junge, und sie benannte ihn nach dem Vater, den er nie gesehen hatte und niemals lieben würde.
Obwohl Edith, die im Juni nach St. Louis fuhr, um bei der Geburt ›auszuhelfen‹, ihre Tochter zur Rückkehr nach Columbia zu bewegen versuchte, wollte Grace nicht kommen; sie besaß eine kleine Wohnung, durch Fryes Rente ein kleines Einkommen, neue Schwiegereltern, und sie schien glücklich zu sein.
»Irgendwie verändert«, sagte Edith gedankenverloren zu Stoner. »Überhaupt nicht wie unsere kleine Gracie. Sie hat eine Menge durchgemacht, und ich schätze, sie will daran nicht mehr erinnert werden … Sie lässt dich lieb grüßen.«
XVI
DIE KRIEGSJAHRE FLOGEN VORBEI , und Stoner überstand sie, wie er einen peitschenden, unerträglichen Sturm überstanden haben würde, den Kopf gesenkt, die Kiefer zusammengepresst, die Gedanken einzig auf den nächsten Schritt gerichtet und den nächsten und den nächsten. Trotz stoischer Duldsamkeit und sturen Voranschreitens über Tage und Wochen hinweg war er jedoch ein zuinnerst zerrissener Mann. Ein Teil von ihm schreckte in instinktivem Entsetzen vor der täglichen Sinnlosigkeit zurück, dem Übermaß an Zerstörung und Tod, mit dem Herz und Verstand unerbittlich konfrontiert wurden; wieder einmal sah er den Fachbereich dezimiert, sah junge Männer die Seminarräume verlassen, sah den gequälten Blick in den Gesichtern jener, die blieben, und sah in ihren Augen den langsamen Tod des Herzens, den bitteren Verschleiß von Mitgefühl und Fürsorge.
Ein anderer Teil von ihm aber fühlte sich von ebenjenem Inferno außerordentlich angezogen, vor dem er zugleich zurückschreckte. Er entdeckte in sich eine Fähigkeit zur Gewalt, von der er bislang nichts geahnt hatte: Er sehnte sich danach, dabei zu sein, sehnte sich nach dem Geschmack des Todes, der galligen Freude des Zerstörens, dem Geruch des Blutes. Er empfand Scham und Stolz, vor allem aber einebittere Enttäuschung über sich selbst sowie über die Zeiten und Umstände, die ihn möglich machten.
Woche um Woche, Monat um Monat zogen die Namen der Toten an ihm vorbei. Manchmal waren es bloß Namen, an die er sich wie aus ferner Vergangenheit erinnerte, manchmal konnte er ein Gesicht damit verbinden, manchmal eine Stimme, ein Wort.
Trotz allem hörte er nicht auf zu unterrichten und zu studieren, obwohl es ihm manchmal vorkam, als krümmte er den Rücken vergebens gegen den peitschenden Sturm und wölbte die Hände gänzlich unnötig um sein letztes armselig flackerndes Streichholz.
Manchmal kehrte Grace nach Columbia zurück, um ihre Eltern zu besuchen. Beim ersten Mal brachte sie ihren kaum einjährigen Sohn mit, doch schien dessen Gegenwart Edith merkwürdig zu beunruhigen, weshalb Grace ihn während der nächsten Besuche bei ihren Schwiegereltern in St. Louis ließ. Stoner hätte den Enkel gern öfter gesehen, verschwieg aber seinen Wunsch, da er begriff, dass Grace’ Fortzug aus Columbia – vielleicht sogar ihre Schwangerschaft – in Wahrheit die Flucht aus einem Gefängnis gewesen war, in das sie nun aus untilgbarer Freundlichkeit und sanfter Gutherzigkeit zurückkehrte.
Obwohl Edith nichts dergleichen vermutete oder es nicht zugeben wollte, hatte Grace, wie Stoner wusste, mit stiller Beharrlichkeit zu trinken begonnen. Zum ersten Mal fiel ihm dies im Sommer nach Kriegsende auf. Grace kam einige Tage zu Besuch und wirkte ungewöhnlich mitgenommen; die Augen umschattet, das Gesicht angespannt und blass. Eines Abends ging Edith nach dem Essen früh zu Bett; Grace und Stoner saßen noch in der Küche und tranken Kaffee. Stonerwollte mit seiner Tochter reden, aber Grace wirkte ruhelos und gereizt. Viele Minuten saßen sie schweigend zusammen, bis Grace ihm schließlich einen inständigen Blick zuwarf, mit den Schultern zuckte und laut seufzte.
»Hör mal«, sagte sie, »hast du vielleicht einen Schnaps im Haus?«
»Nein«, sagte er. »Tut mir leid. Im Schrank könnte noch eine Flasche Sherry sein, aber …«
»Ich brauche unbedingt was zu trinken. Macht es dir
Weitere Kostenlose Bücher