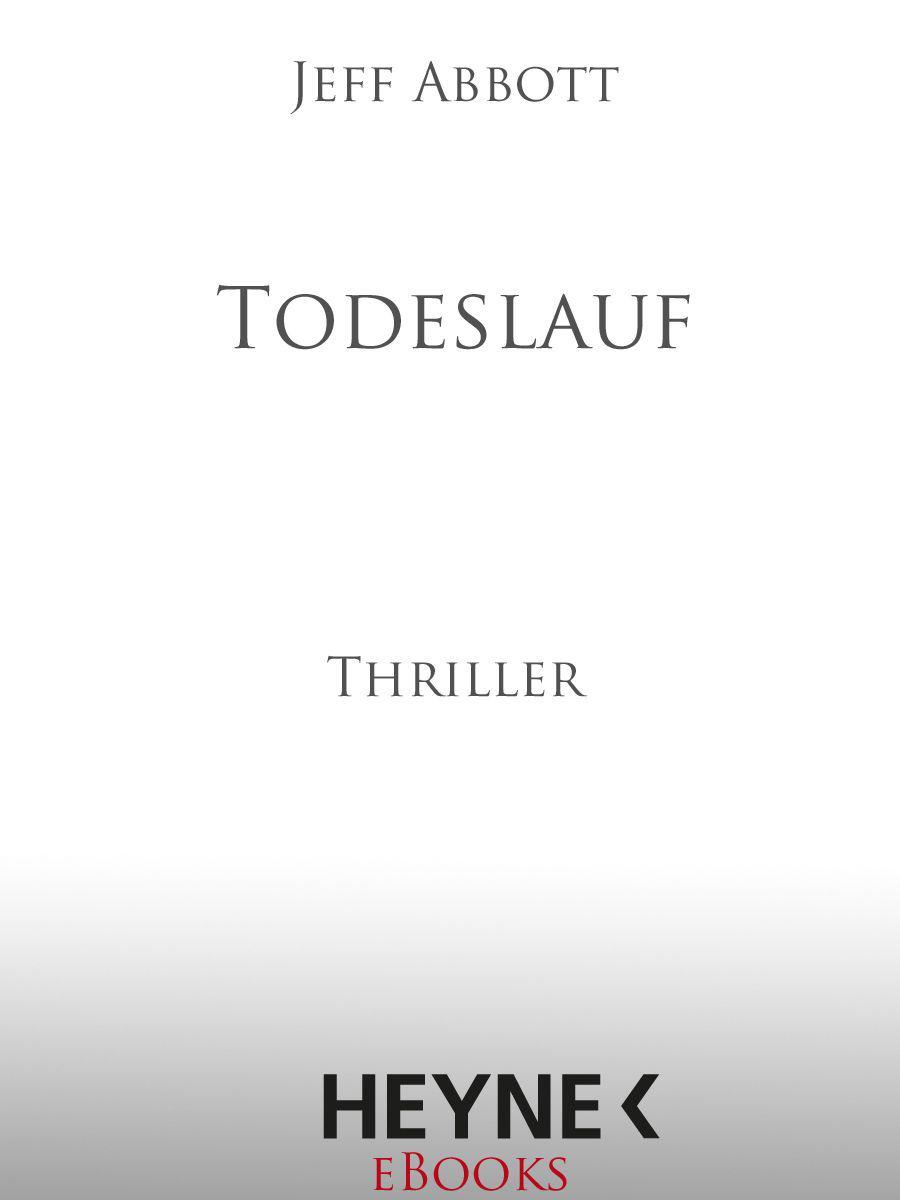![Todeslauf: Thriller (German Edition)]()
Todeslauf: Thriller (German Edition)
Meine Situation auf dem Schiff unterschied sich nicht so sehr von den Phasen der Stille in dem CIA-Gefängnis, außer dass mich hier niemand folterte. Aber die Grenze, die ich überschritten hatte, beschäftigte mich doch jetzt mehr als während der eigentlichen Planungsphase. Howell würde vielleicht die Anweisung ausgeben, mich auf der Stelle zu erschießen, sobald man mich entdeckte. Ich war aus dem unsichtbaren Käfig ausgebrochen. Eine zweite Chance würde ich nicht bekommen.
Als ich aufwachte, schlug ich mithilfe der Taschenlampe mein kleines Lager in der stählernen Kiste auf. In meinem Gepäck befand sich unter anderem die Glock mit zwei Ersatzmagazinen, die ich mir aus Ollies Safe geholt hatte. Außerdem eine hoffentlich wohlschmeckende Auswahl an Proteinriegeln und Obst, Wasserflaschen, Batterien für die Taschenlampe, Zahnbürste, Zahnpasta, Toilettenpapier und ein kleiner Behälter für die Abfälle. Sogar Verbandszeug und Schlaftabletten hatte ich dabei. Und einen iPod mit Musik von Mahler und den Rolling Stones. Schließlich noch Kleider zum Wechseln – zwei graue Hemden und Jeans – und das ganze Geld, das ich seit dem Fiasko mit dem Reisepass gespart hatte, ein paar hundert Dollar.
Es war nicht viel für eine so lange und gefährliche Reise, meine Suche nach Frau und Kind. Ich sah auf meine Uhr. Das Frachtschiff sollte schon abgelegt haben. Ich hörte das leise Summen der Maschinen. Aber ich wollte nicht riskieren, die Tür zu öffnen und vielleicht entdeckt zu werden – obwohl die Wahrscheinlichkeit bei Tausenden von Containern nicht allzu hoch sein konnte. Wenn mich später auf hoher See jemand sah, wäre es etwas anderes gewesen. Wegen eines blinden Passagiers würde das Schiff bestimmt nicht umkehren; sie würden mich nur festnehmen, in irgendeinen kleinen Raum sperren und bei der Ankunft in Rotterdam die Hafenbehörde verständigen. Aber es war sicher besser, gar nicht erst gesehen zu werden. Ich hatte keine Angst, durchzudrehen, wenn ich zehn Tage keinen Himmel sah.
Der Container war wie ein Mutterleib, sagte ich mir. Nach der Reise würde ich vielleicht wie neugeboren sein – bereit, mir die Leute vorzuknöpfen, die meine Frau entführt hatten.
Ich schloss wieder die Augen.
Ich fühlte mich einfach nur allein – auf eine heute eher seltene Art. Es gab nichts zu tun als zu schlafen und von dem zu träumen, was ich verloren hatte. Ja, ich träumte viel, vielleicht zu viel.
Während ich vor mich hindöste, tauchten Bilder in meinem Kopf auf, die kein Traum waren, sondern eine Erinnerung.
»Welchen Namen möchtest du ihm denn geben?«, fragte mich Lucy. Sie stand am Fenster unserer Wohnung in Bloomsbury und blickte hinaus in den Regen. Graue Wolken zogen tief über die Stadt hinweg, und mein normales Leben war noch fünf Tage von seinem abrupten Ende entfernt.
»Ihm. Du bist dir sicher, dass es ein Er ist.«
»Er tritt mich dauernd – so wie du.« Sie legte die Hand auf ihren prallen Bauch.
»Ich hab dich noch nie getreten.«
Sie legte eine Hand an meine Wange. »Doch, im Schlaf. Wenn du Albträume hast. Von Danny.«
Mein Bruder.
Wenn Dannys Name fiel, herrschte immer kurzes Schweigen. Vielleicht nur einen Moment lang, aber es war ein kleiner Bruch im Alltagsleben. Und dann folgte der unvermeidliche Stich. Hinter meinen Augen, in meiner Kehle.
Ich ließ das Buch sinken, das ich gerade las. »Wie wär’s mit Edwin, nach deinem Dad?« Lucys Eltern waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie gerade zehn war, und ich dachte mir, sie würde die Erinnerung an ihren Vater oder ihre Mutter auf diese Weise wachhalten wollen. Nach dem Tod ihrer Eltern war sie von einer Tante großgezogen worden. Auf dem College begann sie sich mit der geordneten Welt der Datenbanken zu beschäftigen, und nach dem Studium heuerte sie – so wie ich – bei der Company an. Sie hatte ihre Tante gerngehabt, doch von ihren Eltern sprach sie nur wenig, so als wären sie Figuren aus einem Roman und nicht die Menschen, die ihre Kindheit geprägt hatten.
»Ich weiß deinen Vorschlag zu schätzen, mein Äffchen, aber Edwin ist mir zu altmodisch.«
»Aha, okay.« Ich sah sie etwas ratlos an.
»Wie wär’s mit Samuel junior?«, schlug sie vor.
»Ich will ihn nicht nach mir benennen. Er soll sein eigener Mensch sein, voll und ganz.«
»Ich würde schon gern einen Namen zur Erinnerung an einen geliebten Menschen auswählen.«
»Na ja.« Ich liebte meine Eltern, sehr sogar, aber mein Verhältnis zu
Weitere Kostenlose Bücher