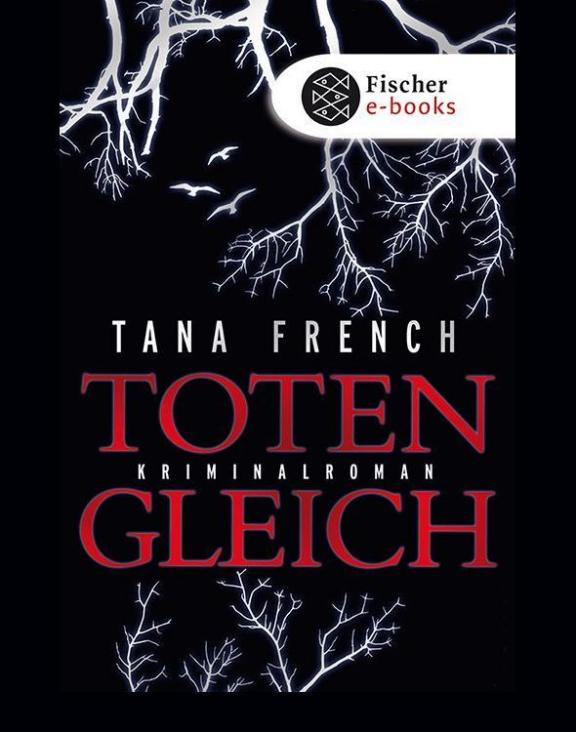![Totengleich]()
Totengleich
soweit ich sehen konnte, keine Menschenseele. Ich zupfte die Blätter und Halme von meiner Kleidung und ging nach Hause, schnell. Lexies Spaziergänge hatten im Durchschnitt eine Stunde gedauert: nicht mehr lange, und die anderen würden sich Sorgen machen. Über die Hecken hinweg konnte ich einen Schimmer vor dem Himmel sehen: das Licht von Whitethorn House, schwach und golden und durchsetzt mit Holzrauch wie Nebel.
Als ich später im Bett noch ein wenig las, klopfte Abby an meine Tür. Sie trug einen rot-weiß karierten Flanellpyjama, das Gesicht frisch gewaschen und die Haare locker auf den Schultern. Sie sah aus wie etwa zwölf. Sie schloss die Tür hinter sich und setzte sich im Schneidersitz ans Fußende meines Bettes, klemmte die nackten Füße in die Kniebeugen, um sie zu wärmen. »Darf ich dich was fragen?«, sagte sie.
»Klar«, sagte ich und hoffte inständig, dass ich die Antwort wusste.
»Okay.« Abby strich sich die Haare hinter die Ohren, warf einen kurzen Blick zur Tür. »Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, deshalb frag ich einfach rundheraus, und du kannst es mir ruhig sagen, wenn du findest, dass es mich nichts angeht. Ist mit dem Baby alles in Ordnung?«
Ich muss völlig baff aus der Wäsche geguckt haben. Einer ihrer Mundwinkel zog sich zu einem schiefen kleinen Lächeln nach oben. »Tut mir leid. Ich wollte dich nicht schocken. Ich hab’s mir gedacht. Wir sind immer auf einer Wellenlinie, aber letzten Monat hast du keine Schokolade mehr gekauft … und dann neulich musstest du dich übergeben, da ist der Groschen gefallen.«
Meine Gedanken überschlugen sich. »Wissen die Jungs Bescheid?«
Abby zuckte die Achseln, ein kurzes Heben einer Schulter. »Ich glaub nicht. Jedenfalls haben sie nichts gesagt.«
Damit war nicht völlig ausgeschlossen, dass einer von ihnen es doch wusste, dass Lexie es dem Vater erzählt hatte – entweder dass sie schwanger war oder dass sie abtreiben wollte – und er ausgeflippt war, aber es wurde unwahrscheinlicher: Abby entging nicht viel. Sie wartete, beobachtete mich. »Das Baby hat es nicht geschafft«, sagte ich, was schließlich die Wahrheit war.
Abby nickte. »Das tut mir leid«, sagte sie. »Es tut mir ehrlich leid, Lexie. Oder … ?« Sie hob dezent eine Augenbraue.
»Ist schon gut«, sagte ich. »Ich wusste sowieso nicht genau, wie ich mich entschieden hätte. Das macht die Sache irgendwie leichter.«
Sie nickte wieder, und ich merkte, dass ich richtig reagiert hatte: Sie war nicht überrascht. »Willst du es den Jungs sagen? Weil, ich kann es machen, wenn du willst.«
»Nein«, sagte ich. »Ich will nicht, dass sie es wissen.« Informationen sind Munition, wie Frank immer sagte. Diese Schwangerschaft könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Ich wollte die Chance nicht vertun. Ich glaube, erst in diesem Augenblick, in dem Augenblick, als mir bewusst wurde, dass ich ein totes Baby in der Hinterhand halten wollte wie eine Handgranate, begriff ich, in was ich mich da hineingeritten hatte.
»In Ordnung.« Abby stand auf und zog ihre Pyjamahose ein Stückchen hoch. »Wenn du mal drüber reden willst oder so, du weißt ja, wo du mich findest.«
»Willst du mich nicht fragen, wer der Vater war?«, sagte ich. Wenn allgemein bekannt war, mit wem Lexie ins Bett ging, dann steckte ich in großen Schwierigkeiten, aber irgendwie glaubte ich das nicht. Lexie hatte anscheinend meist nur so viel wie nötig von ihrem Leben preisgegeben. Aber wenn irgendwer es erraten hätte, dann Abby.
Sie drehte sich an der Tür um und zuckte wieder mit einer Schulter. »Ich schätze«, sagte sie mit betont neutraler Stimme, »wenn du es mir sagen willst, wirst du es tun.«
Als sie fort war – ein flinkes Arpeggio nackter Füße, fast geräuschlos, die Treppe hinunter –, ließ ich mein Buch, wo es war, und lauschte auf die anderen, die sich bereit machten, ins Bett zu gehen: Irgendwer ließ Wasser im Badezimmer laufen, Justin sang unter mir unmelodisch vor sich hin (»Gooooldfinger … «), das Knarren von Dielen, als Daniel sich leise in seinem Zimmer bewegte. Ganz allmählich ließen die Geräusche nach, wurden leiser und sporadischer, verklangen schließlich ganz. Ich schaltete meine Nachttischlampe aus: Daniel würde das Licht unter seiner Tür sehen, wenn ich sie anließ, und ich hatte für einen Abend genug vertrauliche Gespräche gehabt. Selbst als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich nichts anderes sehen als die
Weitere Kostenlose Bücher