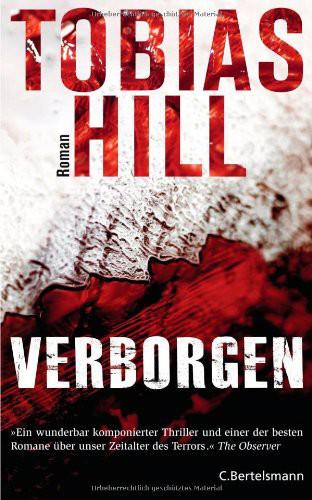![Verborgen]()
Verborgen
Universität hatte ihn nicht besonders interessiert, auch wenn es ihm, wie Ben wusste, nie an Einladungen von Leuten gemangelt hatte, die eine Herausforderung suchten. Sein Ruf hatte ihn zu einem begehrten Objekt gemacht, doch er war offensichtlich zu intelligent gewesen, als dass man mit ihm hätte bekannt sein wollen, selbst in Oxford; seine Intelligenz war ein Panzer. Oder mehr noch, eine Prunkrüstung: Panzer und Prunkrüstung zugleich.
Sie waren bestenfalls Kollegen gewesen, für Freunde hatten sie sich nie gehalten. Sie hatten nichts gemein, das fand Ben selbst. Wieso sollte Sauer sein Glück mit ihm teilen?
Es war nur merkwürdig. Dass ihre Wege sich überhaupt gekreuzt hatten, so klein die Welt auch sein mochte. Dass Eberhard log – und das so kläglich –, obwohl es nichts zu verbergen gab. Allenfalls eine Arbeitsmöglichkeit, bei schlechter Bezahlung, wie so oft auf ihrem Gebiet. Durch die Arbeit hätten sie natürlich wieder zu Kollegen werden können. Hatte Sauer genau das vermeiden wollen?
Zum ersten Mal seit er England verlassen hatte, spürte er ein Hellerwerden, eine schwache Regung des Geistes. Seine Neugierde war ein Ansporn, der ihn, wenn auch noch nicht zum Handeln, so doch dazu bewegte, sich seine Untätigkeit bewusst zu machen. Eine fragiler, aufkeimender Eifer.
Nachts waren seine Gedanken dunkler. Lange verweilten sie dabei, wie er Eberhard kennengelernt hatte. Am selben Tag hatte Emine Foyt kennengelernt. Damals hatte sie den Professor lächerlich gefunden. Auf dem Heimweg von diesem ersten Seminar war sie wütend auf ihn gewesen. Und man konnte sich damals auch leicht über ihn lustig machen, über seine gekünstelte Schüchternheit, seine trockene Lüsternheit, seinen höflichen Stolz. Die Selbstgefälligkeit eines gut aussehenden Mannes, eines Mannes, der nur in seiner eng begrenzten Welt berühmt war.
Sie waren erst wenige Monate zusammen. Emine hatte in diesem Semester mit Freundinnen eine große Wohnung in Risinghurst bezogen, die Bens Mittel weit überstieg; er hatte sein Wohnheimzimmer beibehalten und übernachtete meist bei ihr. Sie waren wegen des Seminars früh in die Stadt gefahren und hatten sich mit Kaffee und Marmorkuchen, den sie sich teilten, an den Senkgarten gesetzt. Das Warten machte Emine unruhig; sie war nervös wegen des Semesterbeginns und des neuen Dozenten. Foyts Zimmer ging auf den Cherwell hinaus, und Emine schaute immer wieder dort hinüber. Sie erzählte von ihrer Schulzeit – von einer Nonne, in die sie verliebt gewesen war, von einem Sommer in Limoges, einem Ausflug zur Île de Ré –, und plötzlich wechselte sie das Thema.
»Welches ist sein Zimmer?«
Er beugte sich an ihr vorbei und zeigte darauf; in der kalten Luft spürte er ihre Wärme an seinem Arm. »Da, am Fellows Garden.«
»Ich geh mal hin.«
»Warum?«
»Weil mir langweilig ist. Und weil er berühmt ist.«
»Berühmt!« Er lachte. »Also komm, Emine…«
Die Angst, sie zu langweilen, hatte ihm einen Stich versetzt, sodass er sie bei ihrem Namen genannt hatte.
»Komm du. Ist doch lustig. Ich möchte hin.«
Und weil sie es wollte, kletterten sie natürlich, auf dem morgenfeuchten Gras rutschend, hinunter. Er murrte, aber Emine brachte ihn zum Schweigen. Er versprach sich nichts davon, doch Professor Foyt war tatsächlich da, nichtsahnend wie ein Fisch im Glas. Nicht etwa halb angezogen oder zerzaust, aber trotzdem lächerlich. Ein gepflegter Mann, nicht größer als Emine, stand er im Halbdunkel des Zimmers vor einem hohen Spiegel und betrachtete sich mit andächtig konzentrierter Miene. Dann hielt er sich die hohle Hand vor Mund und Nase, eine seltsame und zugleich vertraute Geste. Er prüfte seinen Atem.
Das Seminar war nur insofern etwas Besonderes, als Eberhard daran teilnahm; Foyt selbst zeigte so wenig Interesse für seine Studenten wie die meisten anderen Professoren auch und verbreitete sich endlos über die Grundlagen der Archäologie, die modernen Feinheiten des stratigrafischen Prinzips, die bei Grabungen lauernden Gefahren. Ab und zu ließ er seinen Blick zu Emine hinüberwandern, auf deren gekreuzten Füßen die Sonne lag. Die meisten Männer hätten das getan.
»Die Ausgrabung muss unser letztes Mittel sein. Bei unserer Erforschung der Vergangenheit ist sie unser wirksamstes Werkzeug, aber auch das destruktivste. Der Prozess des Ausgrabens bringt zwangsläufig Zerstörung mit sich. Wenn der Archäologe nicht alles birgt, was zu bergen ist, können die Antworten,
Weitere Kostenlose Bücher