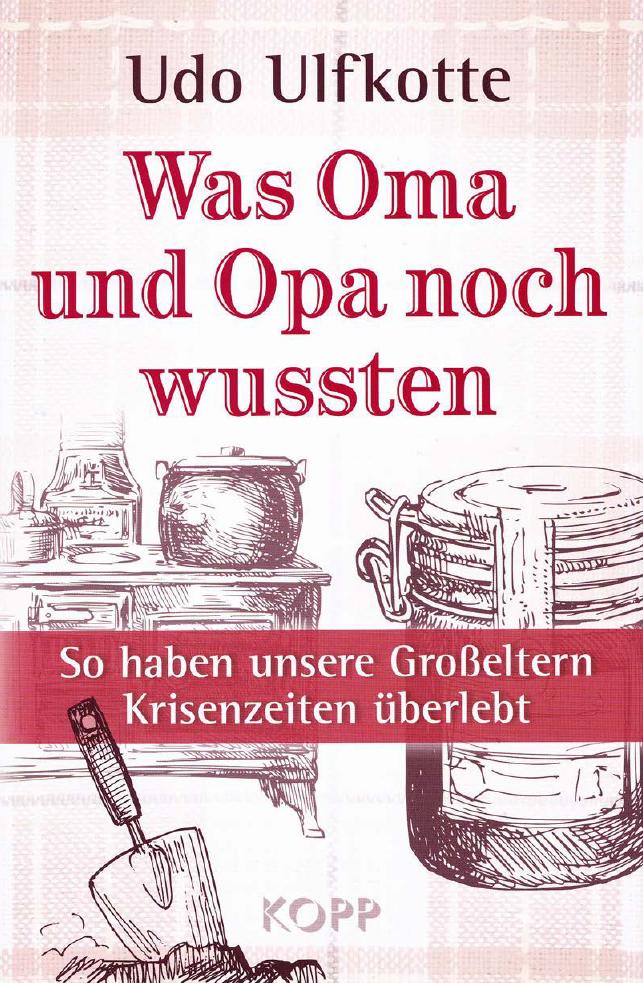![Was Oma und Opa noch wussten]()
Was Oma und Opa noch wussten
Millionen Einwohner Deutschlands in Städ- ten oder in Ballungsgebieten. Das sind 70 Prozent der Bewohner des Landes. Kaum einer von ihnen kann sich in einer Krisenzeit autark selbst versorgen, beim Bauern um die Ecke arbeiten oder auf eigene Nahrungsmittelvorräte zurückgreifen. Es sind genau jene Menschen- gruppen, die bei allen vorausgegangenen Krisen am stärksten gelitten haben. Und genau sie finden es heute völlig »normal«, sich nicht ei- genverantwortlich auf eine Krise vorzubereiten. Ein eigenes Garten- grundstück von zehn mal 15 Metern erbringt bei guter Pflege etwa zwei bis drei Zentner Kartoffeln. Das ist die Jahresration eines Nor- malverbrauchers. Für eine dreiköpfige Familie braucht man also al- lein rund 450 Quadratmeter Kartoffelacker. Welcher Bewohner eines Ballungsgebietes weiß überhaupt noch, wie man Kartoffeln pflanzt, pflegt, von Schädlingen frei hält und erntet? Die Mehrzahl der Men schen überlässt die Sicherung ihres Überlebens wie selbstverständ- lich anderen. Das gilt nicht nur für pflanzliche Nahrung. Die private Hühnerhaltung war im Nachkriegsdeutschland so verbreitet, dass 45 Prozent der Menschen eigene Hühnereier hatten. Nicht anders war es bei Stallhasen oder Gänsen, Enten und Ziegen.
Nun wird ein durchschnittlicher Bürger heute denken, bei einer künftigen Nahrungsmittelkrise fahre er halt einfach aufs Land und beschaffe sich dort die notwendigen Lebensmittel. Das war schon in der Nachkriegszeit schwierig. Man bekam Lebensmittel nur auf dem Schwarzmarkt oder als »Hamsterer«. Damals fanden jene, die aufs Land fuhren, um Lebensmittel für ihre Familien zu holen, noch in- takte Dörfer mit bäuerlichen Betrieben vor. Die Siedlungsstruktur war in jener Zeit eine völlig andere. Alle Städte waren umgeben von einem dichten Kranz kleiner Dörfer. So fanden sich allein in einem Radius von 30 Kilometern um Trier 314 Dörfer, im gleichen Radius um Kaiserslautern 378 Dörfer. Zudem gab es zwischen Stadt- und Landbevölkerung intakte, enge verwandtschaftliche Beziehungen. Die Familienmitglieder halfen sich gegenseitig : Die Städter brachten Werkzeuge und andere Produkte mit und nahmen von ihren Ver- wandten Lebensmittel zurück in die Stadt. Heute sind fast überall die verwandtschaftlichen Bande zerrissen. Und welcher Städter hat noch einen nahen Verwandten, der einen klassischen Bauernhof mit Vieh- wirtschaft, Obst- und Gemüsekulturen betreibt? Unsere Landwirt- schaft besteht aus anonymen Großbetrieben, die Monokulturen pro- duzieren, aber nicht selbst verarbeiten. Was nutzt einem Städter ein Bauer als Verwandter, der riesige Raps- oder Maisfelder bewirtschaf- tet, aus denen dann irgendwo Biodiesel hergestellt wird? Können sich Stadtbewohner heute vorstellen, in Notzeiten Bucheckern zu sam- meln, um diese gegen Öl einzutauschen? Früher hat man das in der Nachkriegszeit so gemacht. Da gab es für sechs Kilogramm Buch eckern einen Liter Speiseöl. Wenn Sie sechs Kilogramm Bucheckern gesammelt und gesäubert haben, dann wissen Sie allerdings, was Sie an dem Tag gemacht haben.
In schweren Zeiten wurde vor allem auch auf dem Schwarzmarkt getauscht: Die Schwarzmarktpreise für Lebensmittel lagen im Som- mer 1945 um das 260-fache über den amtlichen. Bis Ende 1946 redu- zierte sich die Spanne auf das 40-fache, Ende 1947 auf das 20-fache und Ende 1948 auf das Vierfache. Im Jahr 1947 kostete Schwarzbrot auf dem Schwarzmarkt das Vierzehnfache der rationierten Ware, Grieß das Achtzehnfache, Speck das Dreißigfache, Butter, Schmalz und Fleisch das Fünffache. Während damals die Schwarzmarktpreise für diese Grundnahrungsmittel bereits langsam wieder fielen, kam der Schwarzhandel mit Zucker im zweiten Quartal 1947 erst richtig in Schwung. Zucker kostete im dritten Quartal 1947 das Fünfund- vierzigfache der rationierten Ware. Der Naturaltausch stand hoch im Kurs. Man kannte die »Bauernvaluta«, den Speck, und die »Edelvalu- ta«, die ausländischen Zigarettenmarken wie Lucky Strike, Marlboro und Camel. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala standen auch Nylon- strümpfe, Alkohol und Penicillin. Typische Beispiele, was und wie getauscht wurde, waren ein Ofenrohr gegen ein halbes Kilogramm Kaffeemischung, ein Pullover gegen 3,5 Kilogramm Gurken, ein Kilo Zwiebel, zwei Kilo Tomaten, ein Viertel Kilo Pfefferoni und ein hal- ber Liter Essig, ein Herrenhemd gegen ein Kilo Zucker oder ein Bett- einsatz gegen 100 Kilo Kartoffeln. Man tauschte Raucherkarten gegen Milch,
Weitere Kostenlose Bücher