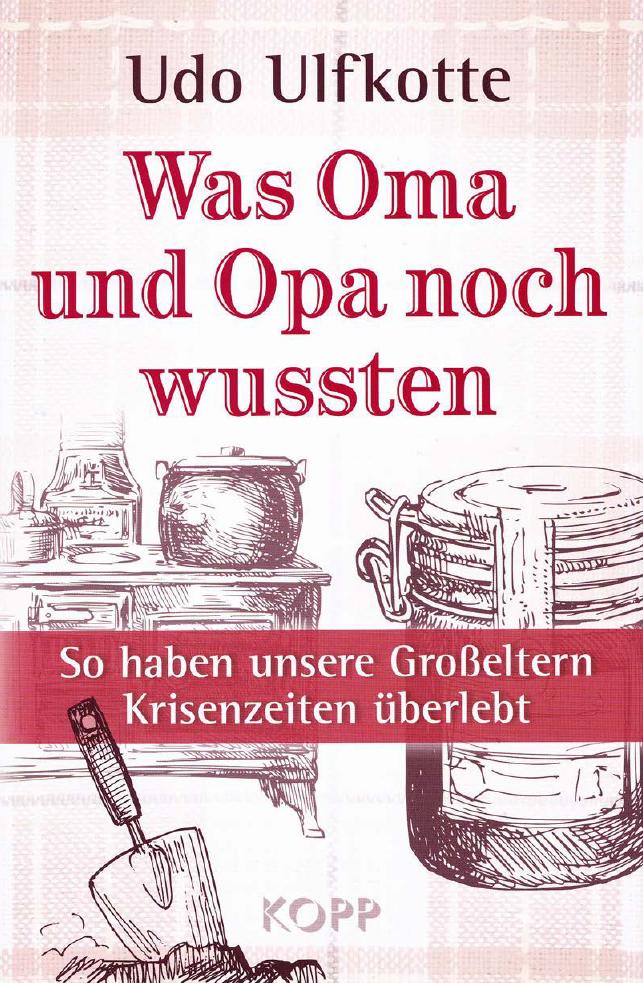![Was Oma und Opa noch wussten]()
Was Oma und Opa noch wussten
Tagen mürbe geworden und gaben einen Festtagsbraten zu Kraut oder Wildgemüse. Und mit den Hasenfettgrieben wurde zusammen mit guten Freunden zum Schluss noch eine Torte gebacken.
In den Schulen gab es in jener Zeit Haferflockensuppe, damit die Kinder nicht verhungerten. Das Rezept: Ein paar Löffel feine Hafer- flocken wurden in etwas Butter angebraten und mit Brühe aufgegos- sen. Man ließ es dann kochen und schmeckte mit einem Suppenwür- fel ab. Viele Familien verdienten sich Geld oder Lebensmittel mit der heimischen Produktion eines Bieres, das man heute längst vergessen hat: Löwenzahn-Brennnessel-Bier. Das nachfolgende Bier-Kriegsre- zept wird wahrscheinlich irgendwann einmal von einem Brauer ent- deckt und als Retrogetränk zu einer neuen Kultmarke gemacht, noch hat es sich niemand patentieren lassen.
Löwenzahn-Brennnessel-Bier
Zutaten: 90 g Löwenzahnblätter • 60 g Brennnesselblätter
22,5 I Wasser • 125 g frische Ingwerwurzel • 1 Zitrone • 1 Orange
2 kg Zucker • 500 g brauner Rohrzucker • 3 EL Bierhefe
Zubereitung: Die gewaschenen Löwenzahn- und Brennnesselblätter, den klein geschnittenen und im Mörser leicht zerstoßenen Ingwer und die abgeriebene Zitronen- und Orangenschale mit 13,5 Liter Wasser in einen großen Topf geben, zum Sieden bringen und dreißig Minuten kochen lassen. Den Zucker in einen zweiten Topf geben und die kochende Flüssigkeit durch ein Sieb dazuschütten. So lange rühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Dann weitere neun Liter Wasser dazugeben, stehen lassen bis die Flüssigkeit nur noch lauwarm ist. Jetzt die Hefe dazugeben. Den Topf mit einem Küchentuch abge- deckt über Nacht an einem warmen Ort stehen lassen. Am nächsten Tag den Schaum von der Oberfläche abschöpfen und das Bier in Fla- schen abfüllen und verschließen. Nach einer Ruhezeit von sieben Ta- gen ist das Bier zum Genuss bereit. Auch in Hungerjahren gab es also Menschen, die alkoholische Getränke bezahlen konnten - und wenn es Löwenzahn-Brennnessel-Bier war.
Eine weitere verheerende Versorgungskrise hatten wir auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Kalorienbedarf Jugendlicher in den Besatzungszonen über mehrere Jahre hinweg nur zu 40 bis 50 Pro- zent gedeckt werden konnte. Die Lebensmittelrationen bestanden von Mitte 1945 bis Mitte 1947 überwiegend aus Kartoffeln (12 bis
15 Kilogramm im Monat) und Brot (200 bis 250 Gramm am Tag), da- nebenmonatlich 300 Gramm Fett (Butter, Margarine, Öl), 125 Gramm Käse und 400 bis 500 Gramm Fleisch. Teigwaren (200 bis 500 Gramm)
wurden erst Mitte 1947, Mehl ab Ende des gleichen Jahres ausgege- ben, Zuckerzuteilungen erfolgten bis Ende 1947 nur sporadisch sechs bis achtmal im Jahr, Milch stand grundsätzlich nur für Kleinkinder zur Verfügung.
Man gewinnt bei der so beschriebenen Ernährungslage als Leser schnell den Eindruck von einer hungernden Gesellschaft, in der die Not in der Nachkriegszeit alle gleichgemacht hat. Das aber entspricht nicht der Wirklichkeit. Den Hunger gab es vor allem beim städti- schen Normalverbraucher, nicht bei der bäuerlichen und nichtbäuer- lichen Landbevölkerung. In längeren Not- und Krisenzeiten gab es schon immer ein beträchtliches Ernährungsgefälle innerhalb der Ge- sellschaft, das Anlass für erhebliche Konflikte gab. So umfasste die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz 1947 2,8 Millionen Menschen, von denen 465.000 (also 16,5 Prozent) bäuerliche Vollselbstversorger wa- ren, die ihren gesamten Bedarf an Hauptlebensmitteln selbst deckten. Sie hatten eine tägliche Kalorienzufuhr, die mindestens doppelt so hoch war wie die Rationen der städtischen Normalverbraucher. Kaum anders waren die Verhältnisse bei den Teilselbstversorgern mit Butter, Fleisch und/oder Getreide, die 390.000 Personen, also 13,9 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Damals waren also in ei- nem Bundesland wie Rheinland-Pfalz 30,4 Prozent der Bevölkerung in Hinblick auf Grundnahrungsmittel von der Ernährungskrise nicht betroffen. Es waren die Städter, die das Bild vom Elend jener Zeit bis heute tief geprägt haben. Dabei stellten die Städter damals nur ein Sechstel der Bevölkerung. Die große Mehrheit der Menschen lebte somit in Dörfern auf dem Land. Viele dieser Menschen hatten eigene Nutzgärten und betrieben Kleinviehhaltung. Und es gab beim Bau- ern um die Ecke stets auch die Möglichkeit zur Beschaffung von zu- sätzlichen Lebensmitteln durch Arbeit oder Tausch. Das alles ist Ver- gangenheit.
Heute leben 58 der 82
Weitere Kostenlose Bücher