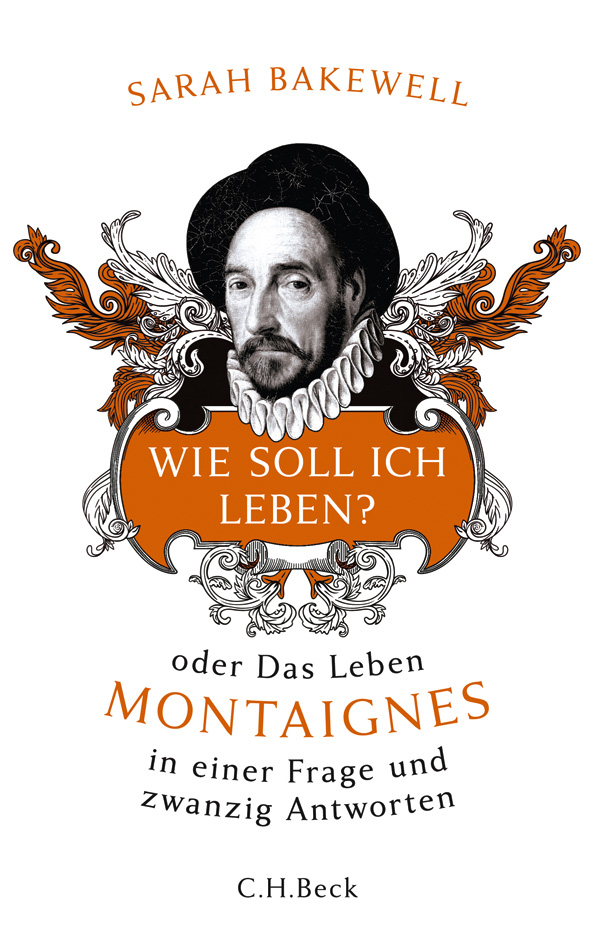![Wie soll ich leben?]()
Wie soll ich leben?
Dinge nämlich, sondern schlechthin alle, und seien sie noch so abstoßend, verwerflich und im Grunde unannehmbar, können unter gewissen Bedingungen und Umständen annehmbar werden.»
Zum Glück war Françoise keineswegs hässlich und abstoßend. Montaigne scheint sie sogar recht attraktiv gefunden zu haben, das jedenfalls behauptete Florimond de Raemond in einer Bemerkung am Rand seiner Ausgabe der Essais . Das Problem lag mehr in der Pflicht zum regelmäßigen Geschlechtsverkehr, denn Montaigne ließ sich nur ungern einengen. Er erfüllte seine ehelichen Pflichten widerstrebend, «nur mit einer Gesäßbacke», wie er gesagt haben würde, tat jedoch alles, was nötig war, um Nachkommen zu zeugen. Auch darauf spielt Florimond de Raemond an, wenn er schreibt:
Ich habe den Autor oft sagen hören, er habe, erfüllt von Liebe, Glut und Jugend, seine Frau zwar geheiratet, die von außergewöhnlicher Schönheit und großem Liebreiz war, dennoch aber habe er sich mit ihr nur in dem Maße vergnügt, wie es sich für die Achtung und Ehre des Ehebetts schickte, und ohne jemals mehr als ihre Hände und ihr Gesicht entblößt zu sehen, nicht einmal ihre Brust, obwohl er im Umgang mit anderen Frauen durchaus lustvoll und ausschweifend war.
Für heutige Leser mag das erschreckend klingen, doch es entsprach den Konventionen. Dass sich ein Ehemann seiner Frau gegenüber wie ein leidenschaftlicher Liebhaber verhielt, galt als moralisch verwerflich, da die Frau auf diese Weise leicht zu einer Nymphomanin werden konnte. Auf ein Minimum beschränkter, freudloser Geschlechtsverkehr war wohl damals das Los einer Ehe. In einem Essai , der sich fast ausschließlich mit Sex beschäftigt, zitiert Montaigne eine antike Weisheit: «Der Mann, sagt Aristoteles, dürfe seine Frau nur zurückhaltend und zuchtvoll berühren, damit sie, falls er sie allzu ungestüm reize, vor Wollust nicht außer Rand und Band gerate.» Auch die Ärzte warnten, sexuelle Ausschweifung könne den Samen des Mannes im Körper der Frau verderben und eine Empfängnis verhindern. Es sei daher besser, wenn der Mann sich anderswo austobe, wo seine Exzesse keinen Schaden anrichten konnten. «Die Könige von Persien», berichtet Montaigne, «luden zu den Festmählern auch ihre Frauen ein; sobald der Wein aber die Männer heftig zu erhitzen begann und sie ihrer Wollust freien Lauf lassen mussten, schickten sie die Gattinnen in ihre Gemächer zurück […], statt ihrer ließ man dann andere Frauen kommen, denen gegenüber man sich zu solcher Rücksichtnahme nicht verpflichtet fühlte.»
Die Kirche stand auf der Seite von Aristoteles, der Ärzte und der Könige von Persien. In Beichtspiegeln aus jener Zeit wird einem Mann, der sich mit seiner Ehefrau in sündiger Wollust ergehe, eine schwerere Strafe verordnet als einem, der sich in gleicher Weise mit einer anderen Frau vergnügte. Wer die Sinne seiner Ehefrau verderbe, gefährde auch ihre unsterbliche Seele und werde damit seiner Verantwortung ihr gegenüber nicht gerecht, so die Überzeugung. Ein verheirateter Mannsolle seine erotischen Leidenschaften daher besser bei einer Frau ausleben, der gegenüber er keine solche Verpflichtung habe. Wie Montaigne bemerkte, sei es den meisten Frauen ohnehin lieber so.
Beim Thema Frauen zeigt Montaigne einen trockenen Humor, doch manchmal klingen seine Bemerkungen durchaus konventionell. Anders als einige seiner Zeitgenossen jedoch scheint er Frauen nicht nur als Gebärmaschinen betrachtet zu haben. Die ideale Ehe war für ihn nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistige Lebensgemeinschaft und strebte «dem Vorbild der Freundschaft nach». Das Problem bestand darin, dass die Ehe im Unterschied zur Freundschaft nicht frei gewählt und damit dem Zwang und der Pflicht unterworfen blieb. Auch war es schwierig, eine Frau zu finden, mit der eine solche Freundschaft überhaupt möglich war, da es den meisten an intellektuellen Fähigkeiten mangelte und ihre Seele, wie er schrieb, «nicht stark genug» schien.
Montaignes Überzeugung von der geistigen Schwäche der Frauen «verwundete» George Sand, wie sie schrieb, «bis ins Herz», zumal sie seine Essais in anderer Hinsicht ausgesprochen anregend fand. Man darf jedoch nicht vergessen, dass im 16. Jahrhundert die meisten Frauen erschreckend ungebildet waren, oft nicht einmal lesen und schreiben konnten und nur über ein dürftiges Weltwissen verfügten. Einige wenige Adelsfamilien engagierten für ihre Töchter Privatlehrer, die
Weitere Kostenlose Bücher