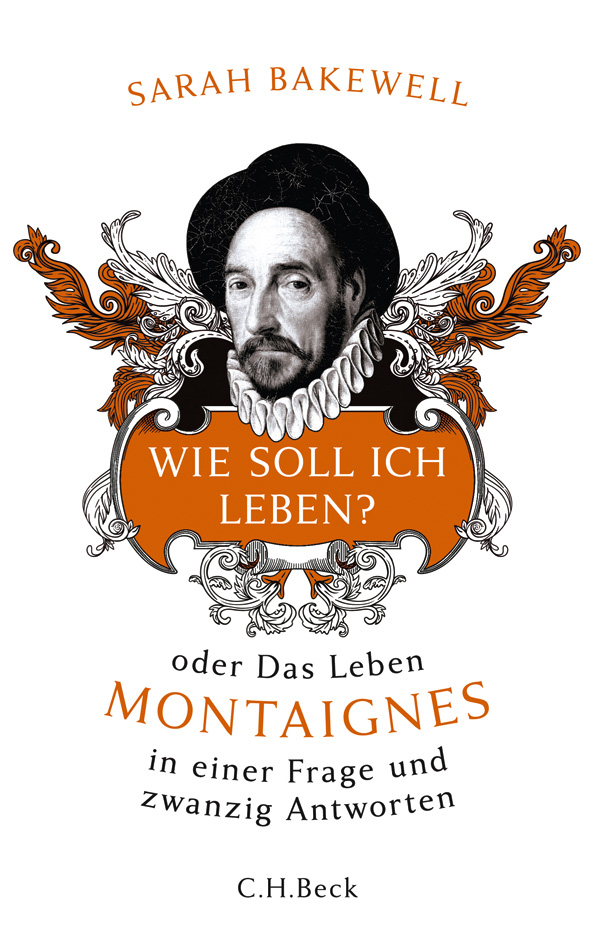![Wie soll ich leben?]()
Wie soll ich leben?
dass diese Offenheit seiner Sicherheitdiente. Schwer bewachte Häuser in dieser Gegend wurden häufiger überfallen als seines. Zur Erklärung zitierte er Seneca: «Verriegelte Türen locken den Einbrecher an, offne lässt er links liegen.» Schlösser erwecken den Eindruck, dass etwas Wertvolles zu holen sei, und ein Haus auszurauben, in dem man von einem älteren Pförtner willkommen geheißen wird, ist nicht gerade eine Ruhmestat. Auch waren in einem Bürgerkrieg die sonst üblichen Vorsichtsmaßnahmen sinnlos, denn da «kann der eigene Diener es mit der Partei halten, die man fürchtet». Gegen eine Bedrohung von innen konnte man sich nicht schützen, da war es besser, den Feind dadurch für sich zu gewinnen, dass man sich offen und aufrichtig zeigte.
Der Erfolg dieser Strategie gab Montaigne recht. Einmal lud er einen Trupp Soldaten ein, bevor er erkannte, dass sie seine Gastfreundlichkeit ausnutzten, um ihn auszuplündern. Doch später gaben sie ihren Plan auf, und der Anführer bekannte, Montaignes «Gesicht» und «sein offenherziges Auftreten» seien der Grund dafür gewesen.
Auch sonst bewahrte ihn seine Offenheit vor gewalttätigen Übergriffen. Als er einmal in einer gefährlichen Gegend unterwegs war, wurde er von fünfzehn bis zwanzig maskierten Männern angegriffen, denen berittene Arkebusenschützen folgten: ein offensichtlich von langer Hand geplanter Überfall. Sie brachten ihn in das Dickicht des nahe gelegenen Waldes, durchwühlten seine Kisten, rissen seine Geldkassette an sich und teilten Pferde und Ausrüstung untereinander auf. Schließlich wollten sie ihn auch noch als Geisel nehmen, wurden sich jedoch über die Höhe des Lösegelds nicht einig. Die Lösegeldsumme setzten sie sehr hoch an, was seinen sicheren Tod bedeutet hätte, weil der Forderung unmöglich zu entsprechen war. Montaigne ergriff die Initiative und gab ihnen zu bedenken, sie hätten doch schon alles an sich genommen, was er bei sich hatte, und eine so hohe Lösegeldsumme würden sie ohnehin nie erhalten. Ein riskanter Vorstoß, dessen war sich Montaigne durchaus bewusst. Doch die Banditen schwenkten um. Nach kurzer Beratung trat der Anführer beinahe freundlich auf Montaigne zu, zog sich die Maske vom Gesicht – eine bedeutsame Geste, da sich die beiden Männer jetzt Auge in Auge gegenüberstanden – und teilte ihm mit, sie hätten beschlossen, ihn ziehen zu lassen. Sie gaben ihm sogar einige seiner Sachen zurück, darunter die Geldkassette.Auch diese Befreiung verdankt sich, so Montaigne später, «meinem Gesicht sowie meinen offenherzigen und unerschrocknen Worten», wie der Anführer ihm versicherte.
Derartige Überfälle waren an der Tagesordnung, und Montaigne dachte oft darüber nach, wie er sich in einer solchen Situation am besten verhalten sollte. War es klüger, sich dem Feind entgegenzustellen, oder sollte man sich gefügig zeigen? Sollte man sich der Gnade des Angreifers anheimgeben und hoffen, dass er Menschlichkeit zeigte und einen am Leben ließ? Oder war das tollkühn?
Das eine wie das andere war ein unwägbares Risiko. Widerstand zu leisten machte vielleicht Eindruck, konnte den Gegner aber auch in Wut versetzen. Mit Unterwürfigkeit appellierte man zwar an das Mitgefühl des Angreifers, konnte aber auch dessen Verachtung heraufbeschwören und in der Folge die rücksichtslose Vernichtung. Außerdem: Wie konnte man sicher sein, dass der Gegner überhaupt Menschlichkeit besaß?
Diese Fragen waren in dem von Gewalt geprägten 16. Jahrhundert nicht leichter zu beantworten als auf einem antiken Schlachtfeld oder in einer modernen Stadt, Auge in Auge mit einem Straßenräuber. Zeitlos gültige Fragen also, auf die Montaigne keineswegs allgemeingültige Antworten hatte. Gerade deshalb beschäftigten sie ihn anhaltend. Immer wieder schilderte er Situationen, in denen zwei Menschen einander feindlich gegenüberstehen: der eine besiegt und um sein Leben flehend oder trotzig Widerstand leistend; der andere entweder Gnade gewährend oder Gnade verweigernd.
In einer solchen Geschichte, die im allerersten Essai erzählt wird, verfolgt der albanische Fürst Skanderbeg im 15. Jahrhundert einen seiner Soldaten, um ihn zu töten. Der Mann fleht um Erbarmen, doch Skanderbeg bleibt ungerührt. In seiner Verzweiflung zieht der Soldat sein Schwert, was Skanderbeg so beeindruckte, dass er den Mann in Gnaden wieder aufnahm. Eine andere Geschichte erzählt von Edward, dem Prinzen von Wales, der eine französische Stadt
Weitere Kostenlose Bücher