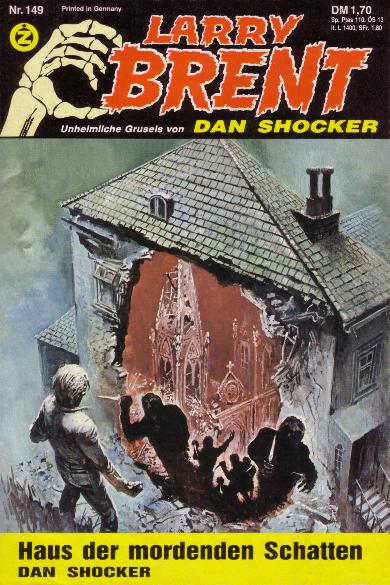![149 - Haus der mordenden Schatten]()
149 - Haus der mordenden Schatten
abblasen und dem
Mädchen den Garaus machen...«
»Du hast den Verstand verloren !« mußte er sich sagen lassen.
Evelyne Masters, die die ganze Zeit über
gedankenversunken und bleich auf ihrem Platz gesessen hatte, wandte den Kopf
und blickte ihr Spiegelbild in den silbern-violett schimmernden Gläsern der
Sonnenbrille ihres Gegenüber an.
»Töten, Charles ?« fragte sie beinahe sanft und kaum hörbar. »Das würdet ihr nie! Und ihr wißt
auch, daß ihr mich damit nicht ängstigen könnt. Ich habe keine Angst vor dem
Tod mehr - ich nicht mehr ...«
Canons Lippen wurden hart. Er wollte etwas
sagen, fuhr aber im gleichen Moment zusammen, da sein Blick aus dem Rückfenster des Chevrolet ging.
Scharf zog der etwa vierzigjährige
braunhaarige Mann die Luft durch die Nase.
»Verdammt«, entfuhr es ihm. »Verdammt, ich
hab’s gewußt. Die Sache geht nicht glatt! Drei Wagen hinter uns nähert sich ein
Polizeifahrzeug auf der Überholspur, Tom !«
*
Gerry Barner war an diesem Nachmittag nicht
mehr fähig, irgend etwas zu tun.
Das kleine Haus, das auf einem Abhang
verborgen hinter Palmen und großen Büschen lag, war von einem klobigen,
handgezimmerten Zaun umgeben. Der Ford stand unter einer offenen, überdachten
Garage, um ihn vor Regen zu schützen. Im Garten und Hof liefen ein paar Hühner
herum, zwei Gänse, an dem sich abflachenden Abhang graste ein Fohlen. Barner
liebte Tiere.
Außer einem Schäferhund, der schon alt und
halbblind war, gab es noch eine gewöhnliche schwarz-weiß gestreifte, rostbraun
gepunktete und mit grauen Flecken versehene Hauskatze, die ihm vor vier Jahren
zugelaufen war und einfach im Haus blieb. In ihr vereinigten sich äußerlich
sehr genau erkennbar eine ganze Anzahl Rassen, und der zugelaufene Kater folgte
von Zeit zu Zeit seinem natürlichen Trieb, und verschwand dann einfach
nächtelang aus dem Haus.
Multi-Point, wie der Kater spitzfindigerweise
hieß, sorgte in der Umgebung von San Pedro für Nachwuchs. Und Gerry Barner, der
von Zeit zu Zeit durch San Pedro kam, konnte an der Zeichnung der dort
herumlaufenden Katzen und neuen Kater erkennen, ob Multi-Point mit von der
Partie gewesen war.
Das Tier begrüßte ihn wie immer schnurrend
und strich um seine Beine.
Doch heute hatte Gerry keinen Blick für den
Kater.
Der Maler ging . anfangs ruhelos durchs Haus. Draußen wurde es schon dämmrig. Die Sonne versank
hinter den bewaldeten Bergspitzen.
Das kleine, verwinkelte Haus, hatte zwei
Etagen.
In der oberen Etage befanden sich die Räume
mit Barners Atelier. Die eine Wand des Hauses unterhalb des Daches bestand in
der Hauptsache aus Glas. Während der Arbeit nutzte der Maler das einfallende
Licht und genoß in den Pausen dazwischen den Blick in die Ferne über die grünen
Äcker und Wiesen, die bewaldeten Höhen, die fernen Felsmassive, die bis zu
zweitausend Meter in den Himmel wuchsen und das tiefe, nun immer dunkler
werdende Blau anzukratzen schienen. Dahinter lag die Mohave-Wüste, »nur«
tausend Meter tiefer, menschenleer und einsam.
Minutenlang stand Barner in dem großen
Atelier. Hier hingen zahlreiche Landschaftsbilder und Porträts, die in ihrer
Sanftheit, Empfindsamkeit und Farbnuancierung auf dem Kontinent nicht ein zweites
Mal anzutreffen waren.
An den Wänden reihte sich ein fertiges Bild
an das andere.
Es waren Bilder von ihr - von Caroline
Barner.
Sie war sein Hauptmodell gewesen. Gerry hatte
sie gemalt und gezeichnet. Bei der Arbeit, beim Klavierspiel, beim Texten, beim
Schlafen. Er hatte sie nackt porträtiert, in Unterwäsche, in einem schwarzen
Kleid, das wie angegossen an ihrem Körper lag, und unter dem sie nichts trug -
als ihre Haut. Das zarte Braun ihres Teints schimmerte durch den
anschmiegsamen, weichen Stoff, zu dem die dunklen, fast schwarzen Augen mit den
langen, seidigen Wimpern in einer Art seltsamer und rätselhafter Harmonie
paßten.
In einer Nische des Ateliers stand ein
uraltes Klavier.
Im Halbdunkel des Raums starrte Gerry Barner
darauf. Vor seinem geistigen Auge entstand ein Bild.
Er sah seine Caroline dort sitzen. Ihre
zarten, beweglichen Finger huschten beinahe wie selbständige Lebewesen über die
Tasten.
Die Melodien, die sie spielte, klangen
schwermütig, ebenso der Text, den sie, leise und ganz in ihren Gefühlen
aufgehend, dazu sang.
Es waren Indianerlieder, die sie sang, alte,
unbekannte Texte, gesungen in einem fremden, wohlklingenden Dialekt, den sie
sich angeeignet hatte. Indianersprachen waren ihre Leidenschaft
Weitere Kostenlose Bücher