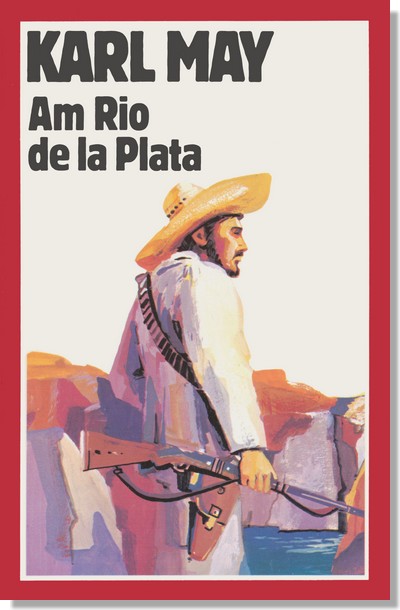![34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata]()
34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata
Reiter nebenher, welcher ohne Unterlaß, mit Grund oder ohne Grund, mit einer großen Hetzpeitsche auf die Pferde losschlägt, um sie anzutreiben.
Dem Vorreiter liegt es ob, dem unbeholfenen Fuhrwerk die Richtung zu geben. Der Kutscher, Mayoral genannt, thront vorn oben, mit einem stereotyp verächtlichen Gesicht, aus welchem zu ersehen ist, daß es ihm höchst gleichgültig erscheint, ob die Fuhre glücklich vonstatten geht oder einige der Pferde totgehetzt liegen bleiben und er beim Umwerfen die gebrochenen Glieder der Passagiere aus dem Wagen auf die Pampa schüttet.
Man erlaubt den Pferden niemals, in Schritt zu gehen; auch der Trab ist selten und fällt dann schlecht und unregelmäßig aus. Meist oder vielmehr stets geht es im sausenden Galopp vorwärts, und grad an den schlechtesten und gefährlichsten Stellen wird dieser Galopp zum Rasen.
So kommt es, daß man per Diligence trotz des miserablen Weges pro Tag bis und über fünfzehn deutsche Meilen zurücklegt, eine Leistung, worüber ein deutscher Postillion den Kopf schütteln würde.
Wenn ich von einem Weg spreche, so ist das nur figürlich gemeint, denn einen Weg gibt es eben nicht. Man sieht keine Andeutung oder Spur eines solchen. Man fährt über die natürliche Fläche, wie sie eben geschaffen ist, und der Europäer traut seinen eigenen Augen nicht, wenn er sieht, daß auf einem solchen Terrain gefahren werden kann.
So geht es über Stock und Stein – auch nur figürlich gemeint, denn Stöcke oder Steine gibt es in der Pampa nicht, desto mehr aber Unebenheiten, ausgetrocknete Bäche und andere Erhöhungen und Vertiefungen, über und durch welche der Wagen wie im Flug fortgerissen und fortgeschleudert wird, so daß die Reisenden unaufhörlich gegeneinanderstoßen und ihnen Hören und Sehen vergehen möchte.
„War das Ihr Kopf, Señor?“
„Nein, der Ihrige, Señorita?“
„Herr, Sie treten mich ja an den Leib!“
„Nein, Señor, Ihr Fuß stieß mir den Schenkel wund!“
„Haben Sie Ihr Leben versichert, Herr Nachbar?“
„Nein, denn wenn ich hier den Hals breche, was höchst wahrscheinlich ist, so bekommen lachende Erben den Betrag. Ich habe keine Familie.“
„Sie Glücklicher! Ich habe Frau und Kinder. Seit ich in dieser Diligence sitze, kann ich sie mir nur noch als verwitwet und verwaist denken.“
Solche und ähnliche Interjektionen, scherzhaft oder ernst gemeint, ertönen unablässig aus dem Mund der Passagiere, welche für ihr teures Geld am Rande des Todes dahingezerrt werden.
Der Kutscher schreit; der Vorreiter brüllt; der hinterste Peon wettert; der Seitenreiter flucht und haut wie verrückt auf die armen Tiere ein, welche, hungernd und entkräftet, kaum mehr vorwärts können. Die wilde Jagd geht steil bergab in den Fluß hinein, welcher hoch aufschäumt. Halb vom Wasser getragen und halb von den Pferden gerissen, gelangt der Wagen, als ob er einzelne Sprünge mache, an das andere Ufer und wird unter Heulen, Schreien und Peitschenhieben an demselben emporgezerrt. Dort hält die zerlumpte Schar. Ein Pferd ist gestürzt. Man durchschneidet den Riemen, mit dem es an den Wagen gehängt war, nimmt ihm den Sattel ab, und dann geht es weiter, weiter, weiter!
Dem Pferd hängt die Zunge aus dem weit offenen Maul. Seine Flanken schlagen, und aus den Augen bricht ein jammernder Blick. In zwei – drei Minuten ist es von Raubvögeln umgeben, welche nur auf die letzten Bewegungen des zu Tode gehetzten Tieres warten, um ihm das warme Fleisch von den Knochen zu reißen.
Überall sieht man die gebleichten Knochen dieser armen Geschöpfe auf der Pampa liegen. Kein Mensch denkt sich etwas dabei. Pferde gibt es im Überfluß. Eine Stute kostet nach deutschem Geld zwölf bis sechzehn Mark. Man schämt sich, auf Stuten zu reiten. Diese Tiere haben so wenig Wert, daß man mit ihren Knochen und ihrem Fett die Ziegelöfen heizt.
Einen Stall gibt es im ganzen Land nicht. Die Pferde befinden sich bei Tag und Nacht, zur Winters- und Sommerszeit, in Sonnenglut und Gewitterstürmen im Freien. Sie genießen nicht die geringste Pflege. Eine Fütterung mit Hafer, Mais oder Heu gibt es nicht. Das Tier hat eben für sich selbst zu sorgen. Das einzige, was der Besitzer tut, ist, daß er ihm seinen Stempel einbrennt. Braucht er es, so wird die Herde von den Peons oder Gauchos in den Korral gehetzt und man fängt sich das betreffende Pferd mit dem Lasso heraus.
Uruguay wird von den Bewohnern desselben die Banda oriental, d.h. die östliche Seite,
Weitere Kostenlose Bücher