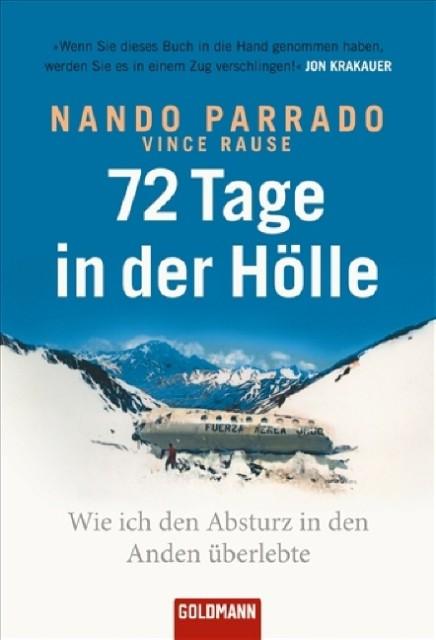![72 Tage in der Hoelle]()
72 Tage in der Hoelle
befand. »Wenn unter diesem Schnee ein Felsen ist, bin ich tot«, dachte ich nur. Sekunden später rammte ich mit voller Geschwindigkeit die Schneewehe. Der Aufprall machte mich benommen, aber der weiche Schnee dämpfte den Stoß, und ich blieb am Leben. Als ich mich hochgerappelt und den Schnee von der Kleidung geklopft hatte, hörte ich von oben Robertos schrille Falsettstimme. Die Worte konnte ich nicht verstehen, aber ich wusste, dass er außer sich über meine Unvorsichtigkeit war.
Mit einem Winken zeigte ich ihm, dass alles in Ordnung war, und dann wartete ich, während er sich vorsichtig seinen Weg zu mir herunter suchte. Gemeinsam gingen wir weiter bergab, und am späten Nachmittag hatten wir den Abstieg vom Berg zu zwei Dritteln hinter uns gebracht. An der Absturzstelle hatten die Schatten der westlich gelegenen Berge die Tage verkürzt. Hier auf der Westseite dagegen blieb es bis in den Abend hinein hell, und ich wollte jeden Augenblick nutzen.
»Lass uns weitergehen, bis die Sonne untergeht«, sagte ich.
Roberto schüttelte den Kopf. »Ich muss mich ausruhen.«
Ich sah, dass er erschöpft war. Mir ging es nicht anders, aber die Angst und Verzweiflung, die mich antrieben, waren stärker als die Müdigkeit. Monatelang hatte sich ein zwanghafter Drang zur Flucht in mir aufgestaut. Jetzt war er losgelassen und geriet außer Kontrolle. Wir hatten den Berg erobert, der uns an der Absturzstelle festgehalten hatte, und jetzt lag vor uns ein offenes Tal, das uns den Heimweg wies. Wie konnten wir da anhalten und uns ausruhen?
»Nur noch eine Stunde«, sagte ich.
»Wir müssen Pause machen«, schnauzte Roberto. »Wir müssen vernünftig sein, sonst sind wir irgendwann am Ende.« Seine Augen waren trüb vor Müdigkeit, aber in ihnen lag auch Entschlossenheit, und ich wusste, dass Diskutieren keinen Zweck hatte. Auf einem flachen, trockenen Felsen breiteten wir den Schlafsack aus, schlüpften hinein und begaben uns zur Nachtruhe.
In der geringeren Höhe und vielleicht auch weil der Felsen den ganzen Tag über die Sonnenwärme gespeichert hatte, war diese Nacht nicht unangenehm kalt. Der nächste Morgen war der 15. Dezember und der vierte Tag unserer Wanderung. Als die Sonne aufging, weckte ich Roberto, und wir machten uns bergab auf den Weg. Irgendwann gegen Mittag erreichten wir den Fuß des Berges und standen am Eingang zu dem Tal, das uns in die Zivilisation führen sollte. Auf dem sanft geneigten Talboden zog sich Gletschereis hin; wie ein Fluss wand es sich zwischen den hohen Bergen hindurch, die sich beiderseits des Tales erhoben. Aus der Ferne sah der Gletscher aus wie glattes Glas, aber das war eine Illusion. Bei näherem Hinsehen erkannten wir, dass die Gletscheroberfläche zersprungen war und aus unzähligen kleinen Eisbrocken und unregelmäßig geformten Platten bestand. Es war ein schwieriges Gelände, und wir stolperten bei jedem Schritt, als würden wir über Haufen von Betontrümmern wandern. Die großen Schneeklumpen rollten hin und her oder verschoben sich unter unseren Füßen. Unsere Fußgelenke wackelten, die Füße glitten aus oder rutschten in die engen Spalten zwischen den Brocken. Es war ein schwieriges, schmerzhaftes Vorwärtskommen – jeden einzelnen Schritt mussten wir sehr vorsichtig setzen, denn wir wussten beide, dass ein gebrochener Knöchel in dieser Wildnis einem Todesurteil gleichkam. Ich fragte mich, was geschehen würde, wenn einer von uns sich verletzte. Würde ich Roberto zurücklassen? Würde er mich zurücklassen?
Den ganzen Tag stolperten wir so über den Gletscher. Die Stunden verrannen. In dem unebenen Gelände hatten wir beide zu kämpfen, aber ich behielt mein besessenes Tempo bei und gewann einen immer größeren Vorsprung vor Roberto. »Langsam, Nando!«, rief er dann. »Du bringst uns noch um!« Im Gegenzug drängte ich ihn, schneller zu machen, und wenn ich warten musste, bis er aufgeholt hatte, ärgerte ich mich jedes Mal über die vergeudete Zeit. Andererseits wusste ich, dass er Recht hatte. Robertos Kräfte waren fast am Ende. Auch bei mir ließen sie nach. In den Beinen plagten mich schmerzhafte Krämpfe, die jeden Schritt zur Qual machten; mein Atem ging zu schnell und zu flach. Ich wusste, dass wir uns zu Tode anstrengten, aber ich brachte es nicht über mich, anzuhalten. Die Zeit lief uns davon, und je schwächer ich wurde, desto hektischer marschierte ich weiter. Meine Schmerzen spielten jetzt keine Rolle mehr – der Körper war nur noch ein Vehikel.
Weitere Kostenlose Bücher