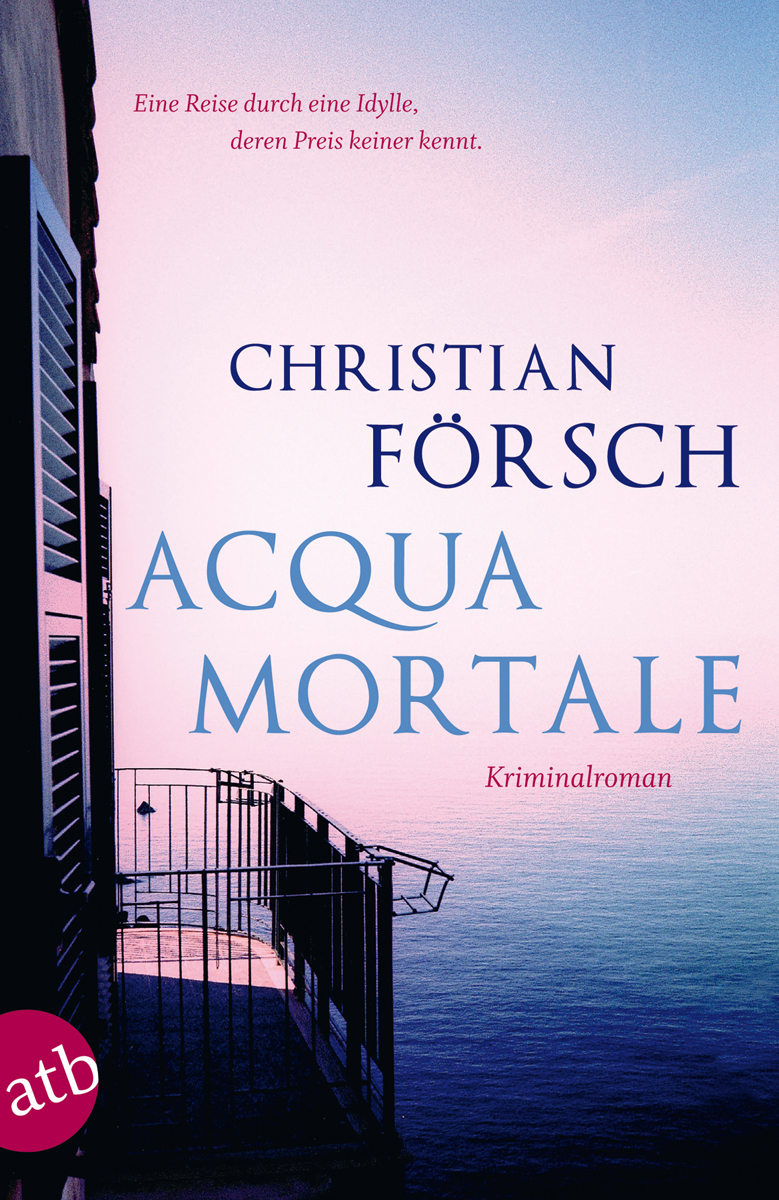![Acqua Mortale]()
Acqua Mortale
Halluzinationen? Nicht nur akustische, jetzt auch visuelle? Die Bilder, die er im Moment sah, passten zu den Geräuschen. Pirri und Di Natale waren mit Pirris weißem Geländewagen unterwegs gewesen. Darin stimmten die Aussagen Silvias und Pirris überein, und sie deckten sich mit den objektiven Fakten. Was zu keinem der Fakten passte, war dieses Bild von Di Natales Gesicht in Lunaus Kopf. In einem blauen Punto. Es musste eine Halluzination gewesen sein. Die Erosion in seinem Hirn ging also weiter. Immer nach demselben Muster: Lunau sah sich als Zeuge oder gar als Opfer dramatischer Situationen. Genau wie Jette sagte. Er wühlte im Dreck, bis er auf Katastrophen und Konflikte stieß, auch da, wo keine waren. Er war paranoid. Hypochonder und Paranoide waren gewöhnliche Egoisten, nur investierten sie ein bisschen mehr Phantasie in ihren Egoismus. Sie erschlichen sich Zuwendung und andere Privilegien, ohne sich dafür schuldig fühlen zu müssen. Lunau wurde übel. Er stellte sich Di Natales letzte Sekunden vor, den Atemreflex, den er zu beherrschen suchte, bis dieser stärker war als Di Natales Wille. Das Wasser, das er in gierigen Schüben in die Atemröhre sog, dann in die Bronchien, die Angst zu ersticken, der Hustenreiz. Pirri hatte am Ufer gestanden, zugesehen, wie der Freund sich auf das Ufer zubewegte, in bleischweren Kleidern, und dann hatte er dessen Kopf einfach unter Wasser gedrückt, immer wieder. War das glaubhaft? Ja. Panik, Wut, Demütigung. Pirri hatte die Kontrolle verloren. Ein kleines mieses Verbrechen unter Freunden, wegen 20 000 Euro. Unter Freunden, die hinter ihrer gutbürgerlichen Fassade ein paar schäbige Laster versteckten. Banal, deprimierend.
Lunau las noch einmal die beiden Artikel, für den Beitrag im Carlino zeichnete »Amanda Schiavon« verantwortlich. Das machte Lunau stutzig. Hatte sie nicht jahrelang versucht, beimKonkurrenzblatt einen Artikel zu platzieren? Das angeblich liberaler war? Warum war sie ausgerechnet beim Carlino zum Zug gekommen? Er betrachtete das Foto noch einmal, Pirris gehetzten Blick, die Schweißflecken, die sich unter seinen Achseln abzeichneten. A. S. stand unter dem Bild: Amanda Schiavon. Warum hatte sie Lunau dieses Foto nicht gezeigt?
Wenigstens hatte sie ihren Ehrgeiz besänftigt. Für Lunau war die Reise ein Schlag ins Wasser gewesen. Er würde die restlichen Stunden darauf verwenden, seine Hörbilder zu ergänzen. Er würde eine idyllische Welt mit Vogelgesang und sanftem Wellenschlag besingen. Damit die Radiohörer sich im deutschen Winter an der Vorstellung wärmten, dass es südlich der Alpen eine bessere Welt gab.
Der Kellner kam und nahm die leere Tasse mit. »Soll es noch etwas sein?«, fragte er. Lunau sah auf die Tische der anderen Gäste. Die Sonne blinkte auf den Biertulpen. Zwei Amerikanerinnen nervten ihn mit ihrer grundlosen Fröhlichkeit. Sie hatten den rhabarberroten Spritz bestellt, die Mischung aus Prosecco und Aperol, die man als Aperitif zu sich nahm, erfrischend, bitter, geringer Alkoholgehalt. Seine Zunge wurde trocken, sein Hirn verlangte nach einem schnellen Trost. Dafür, dass er wieder eine Woche einer Schimäre nachgejagt, eine Woche der wenigen Jahre verschwendet hatte, in denen der gesunde Teil seines Gehirns noch die Kontrolle über den kranken behielt. Oder war es bereits umgekehrt? Die Amerikanerinnen bemerkten seinen Blick und prosteten ihm zu.
Lunau bezahlte und ging zu dem Leihwagen, an dem ein Strafzettel hing. Fast 40 Euro.
41
Die restlichen Stunden des Tages verbrachte Lunau damit, seine Aufnahmen zu komplettieren. Er hörte seine Interviews durch, suchte noch einmal den ehemaligen Brückenwärter und die Fährfrau auf und zeichnete die Geräusche der Schwimmbagger und Nebelhörner sauber auf. Es war ein windstiller Nachmittag, die Bedingungen günstig.
Amanda rief an und bat ihn um ein Treffen. Sie wollte sich von ihm verabschieden. Lunau fuhr an die entsprechende Stelle am Deich und wartete.
Vor ihm lag das Vorland, schwarze schlanke Baumstämme, die eine dunkelgraue Fläche schraffierten. Der Fluss machte einen weiten Bogen und hatte in jahrhundertelanger Arbeit einen schneeweißen Sandstrand aufgeschüttet. Den Lido. Einst ein Anziehungspunkt für die Landbevölkerung aus den umliegenden Dörfern und für die Ferrareser, die es rustikal liebten. Hier hatten Strandlokale gestanden, einfache Bretterbuden mit Schilfdächern, Gläser mit Brausen und Bier wanderten über den Tresen, Liegestühle und Tretboote
Weitere Kostenlose Bücher