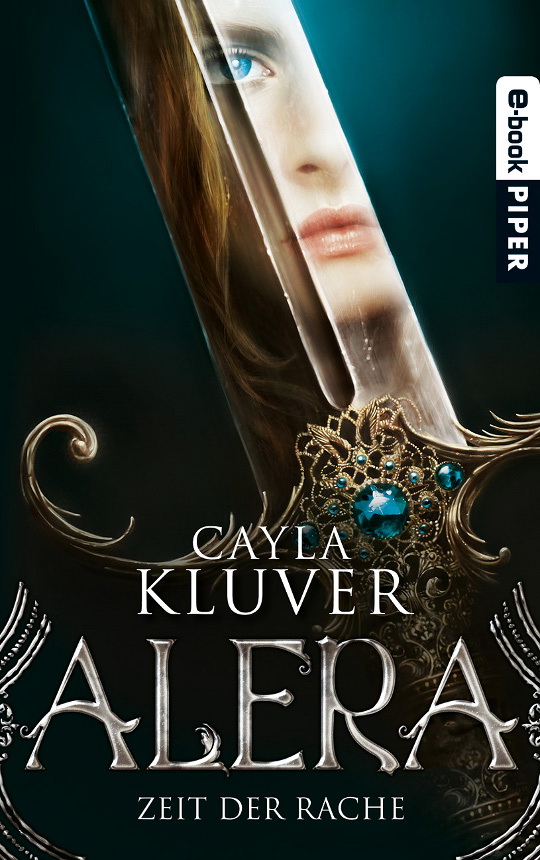![Alera 02 - Zeit der Rache]()
Alera 02 - Zeit der Rache
einem der Ledersessel, die Zeit mit einem Gedichtband zu vertreiben. Mein Mann war dem Abendessen ferngeblieben (ironischerweise ebenso wie mein Vater) und bisher noch nicht in unseren Gemächern aufgetaucht, obwohl es selbst für seine Verhältnisse bereits reichlich spät war. Ich wusste, dass er sich im Palast aufhielt, denn ich hatte im Verlauf des Tages ein- oder zweimal den seltsam blassen Galen gesehen. Und außerdem wäre das Getuschel innerhalb der Dienerschaft unüberhörbar gewesen, wäre der König seinen täglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Stattdessen machten Gerüchte die Runde, der Haushofmeister litte unter selbst verschuldeten Beschwerden, wobei ich mir nicht sicher war, was genau das bedeuten sollte.
Ich merkte, dass ich las, ohne zu begreifen, weil meine Augen zwar die Buchseiten überflogen, meine Gedanken jedoch ganz woanders waren. Nach dem Streit mit meinem Vater hatte ich mich seltsam befreit gefühlt, denn künftig wäre ich von seinem Urteil und seinen Erwartungen unabhängig. Dieses Gefühl hatte mir so viel Selbstvertrauen geschenkt, dass ich zur Versöhnung mit Steldor bereit war.
Im Verlauf der letzten guten Stunde hatten jedoch wieder Zweifel an mir zu nagen begonnen. Mein Vater ging mir derzeit aus dem Weg, aber immerhin lebte er im Schloss und folglich würden wir uns fast täglich sehen. Wie sollte da unser Verhältnis aussehen? Wir könnten höflich miteinander verkehren, dessen war ich mir sicher. Aber würden wir jemals wieder liebevoll zueinander sein? Oder hatte ich unumkehrbare Fakten geschaffen? Und wenn dem so sein sollte, war das dann zwingend etwas Negatives?
Ich legte mein Buch beiseite und versuchte, mich auf das Nächstliegende zu konzentrieren – was sollte ich zu Steldor sagen, wenn – nein, falls – er käme? Es war immerhin möglich, dass er diese Nacht wie schon die vergangene bei Galen verbrachte oder unsere Gemächer erst aufsuchen würde, wenn er sich sicher sein konnte, dass ich schon schlief. Beides würde bedeuten, dass er nicht mit mir reden wollte. Wenn ich an seine jüngsten Wutausbrüche dachte, dann war es unter Umständen auch kein Fehler, ihm aus dem Weg zu gehen.
Wie aufs Stichwort trat Steldor ein – und zwar so leise, dass ich ihn erst bemerkte, als er sich räusperte. Aus meinen Gedankenspielen gerissen schreckte ich hoch und sah zur Tür, von wo aus er mich angrinste, und kam mir vor wie ein Kind, das man beim Tagträumen erwischt, während es eigentlich lernen sollte. Als er aus dem Schatten ins Licht der Laterne trat, fiel mir seine ungewöhnliche Blässe auf, er sah regelrecht grau und kränklich aus. Ungewöhnlich müde ließ er sich schwer auf das Sofa fallen, streckte sich der Länge nach darauf aus und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Es gelang mir nicht, seine Stimmung einzuschätzen, aber ich vermutete, dass es ihm nicht besonders gut ging.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich vorsichtig.
»Ging mir schon mal besser.«
»Du hast das Abendessen ausgelassen. Vielleicht könnte ich dir etwas –«
»Hab keinen Hunger.«
Ich schwieg verunsichert, da fiel mein Blick auf einen Krug mit Bier auf dem Tisch vor dem Sofa.
»Vielleicht würde dir ein Schluck Bier guttun«, schlug ich vor und wünschte, er würde darauf eingehen und mir sagen, was mit ihm los war.
»Bier ist sicher das Allerletzte, was mir jetzt fehlt«, verkündete er. Bevor ich mir einen Reim auf diese Äußerung machen konnte, fragte er schleppend: »Warum bist du denn noch auf und wartest auf mich?«
»Um mit dir zu reden«, antwortete ich und setzte auf Ehrlichkeit.
»Aha.«
Ich begann zu begreifen, dass ich wohl den Löwenanteil des Gesprächs zu bestreiten hätte.
»Ich möchte mich entschuldigen«, fuhr ich fort und schluckte den Kloß hinunter, der in meinem Hals zu stecken schien, »für mehrere Dinge.«
»Entschuldigung angenommen. Ich verzeihe dir.«
Ich runzelte die Stirn und rang die Hände in meinem Schoß, denn das Gespräch lief nicht besonders vielversprechend. »Ich habe doch noch nicht einmal gesagt, wofür ich mich entschuldigen will!«, protestierte ich.
Er stöhnte auf und presste sich als Reaktion auf meine erhobene Stimme eine Hand an die Stirn. Dabei rutschte sein Hemd bis zum Ellbogen und ich konnte den Verband um seinen Unterarm sehen.
»Ich bin ganz Ohr«, murmelte er und deutete mit dem Arm vage in meine Richtung. »Kein Grund laut zu werden. Dann entschuldige dich in Gottes Namen.«
Ich beschloss, am Anfang
Weitere Kostenlose Bücher