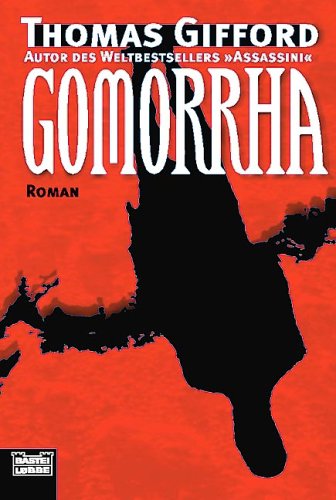![Ben Driskill - 02 - Gomorrha]()
Ben Driskill - 02 - Gomorrha
lag der cremefarbene Teppich da, der alle zwei Wochen gereinigt werden mußte. Die Bilder aus Renos Zeit – viele Fotos auf dem Land mit Freunden oder mit ihrer Mutter auf den Wasserstraßen Floridas – waren natürlich verschwunden und durch ähnliche Fotos aus Teresas Leben ersetzt worden. Ben sah ein Bild, wo er mit Teresa an der Reling eines Schiffs der Circle Line Cruises stand, mit dem sie nachts eine Fahrt um Manhattan gemacht hatten. Sie lächelten. Er hatte den Arm um sie gelegt, im Hintergrund die erleuchtete Skyline.
Teresa ging weiter in ein noch kleineres Zimmer mit schwarzen Ledermöbeln, einem Fernseher und einer Bar. Sie machte zwei Wodka-Tonic. Von Gin bekam sie immer Kopfschmerzen.
»Ich habe seine Leiche gefunden.«
Sie zuckte zusammen und blickte auf.
»Du? Ich dachte, es sei der Hubschrauberpilot oder der Hausmann …«
»Nein, ich war zuerst da.«
»Wann?«
»Mitten in der Nacht.«
»Warum?« Sie schien ihren Ohren nicht zu trauen. Eine zweite Frage brach hervor. »Weiß das der Präsident?«
»Ich habe ihn sofort angerufen, nachdem ich die Leiche gefunden hatte. Er hat mir gesagt, ich sollte schleunigst abhauen und keiner Menschenseele etwas sagen. Er wollte, daß ich sofort herkomme. Und so bin ich gekommen.«
Auf Teresas Gesicht stand Staunen, Trauer, Schock. Ben erzählte ihr die ganze Geschichte. Sie stellte die gleichen Fragen wie die anderen, stellte die gleichen Mutmaßungen an, machte Ballard Niles und der Gerüchtekampagne, die den Präsidenten angriff, schwere Vorwürfe. Sie lehnte sich im Ledersessel zurück, schlug die Beine übereinander und machte die Knöpfe bei dem Marinejackett auf, das große Goldknöpfe, Streifen an den Ärmeln und einen steifen Kragen hatte. Sie war schon so lange im Geschäft und hatte so viel gesehen, daß sie ihren Schmerz über Summerhays’ Tod unterdrücken konnte. Sie war bereits weiter, jenseits ihrer Gefühle.
»Ich wünschte, ich könnte noch mal mit Drew sprechen«, sagte sie. »Aus verschiedenen Ecken habe ich gehört, daß die Republikaner eine Art Untersuchung wegen dieser blinden Gerüchte erwägen, Untersuchungen über das Weiße Haus und Drew, in Zusammenhang mit irgendwelchen vagen Unregelmäßigkeiten. Einige Leutchen möchten auch eine Überprüfung von Bascomb, Lufkin und Summerhays – nein, ich mache keine Witze – wegen unzulässiger Beeinflussung der Politik und Gefälligkeiten für Mandanten. Alles natürlich ›zum Wohl des Landes‹. Der Minderheitenführer des Repräsentantenhauses, Arch Leyden, hat angeblich vor, mir einen Besuch abzustatten, um mit mir zu plaudern – du hast ihn doch gehört, diese brüchige hohe Stimme: Gibt es irgendwelche faktischen Gründe für diese Gerüchte? Sitzen wir auf einem Pulverfaß? Er wird von mir einen speziellen Staatsanwalt vom Justizministerium verlangen. Ich habe vor zehn Tagen mit Drew über die Wahlkampfbedingungen gesprochen, und er hat gesagt, wir müßten planen, Verteidigungen um die Regierung aufzubauen – doch zuvor – diesen Punkt hielt er für ungemein wichtig – müßten wir herausfinden, wogegen wir uns verteidigen. Der Präsident ist eine lebende Schießscheibe, eine Silhouette vor dem Mond – so hat er es beschrieben. Wir wollten uns bald wieder darüber unterhalten.« Sie schluckte den plötzlichen Wunsch, zu weinen, hinunter.
»Ich habe nochmals mit ihm geredet«, fuhr sie fort, »vor drei oder vier Tagen. Ich war darauf vorbereitet, ein fundiertes Gespräch über unsere Sorgen zu führen. Aber er war nicht so spezifisch, wie ich erwartet hatte, nachdem er so nachdrücklich auf diesem Gespräch bestanden hatte. Nein, es war alles allgemein und vage. Damals dachte ich, es käme daher, daß er vielleicht mit jemand anderem gesprochen hatte, dem er irgendwie mehr traute, und deshalb beschlossen hatte, mit mir nicht so offen zu sprechen, wie ursprünglich geplant. Wie auch immer – er sagte, diese ganze Kampagne gegen Bonner sei … ein Taschenspielertrick. Ja, so drückte er sich aus. Jetzt siehst du’s, jetzt siehst du’s nicht. Ich erinnere mich an seine genauen Worte: ›Wir sind alle in einer riskanten Situation. Wir alle. Wir laufen Gefahr, eingeschmolzen zu werden. So etwas habe ich noch nie gesehen.‹ Das hat er tatsächlich gesagt, und er hat alles in einer Million Jahren gesehen. Ja, ›so etwas habe ich noch nie gesehen‹.«
»Aber was? Was hat er noch nie gesehen?«
»Er wollte nicht mehr sagen«, antwortete Teresa. »Aber kurz ehe er
Weitere Kostenlose Bücher