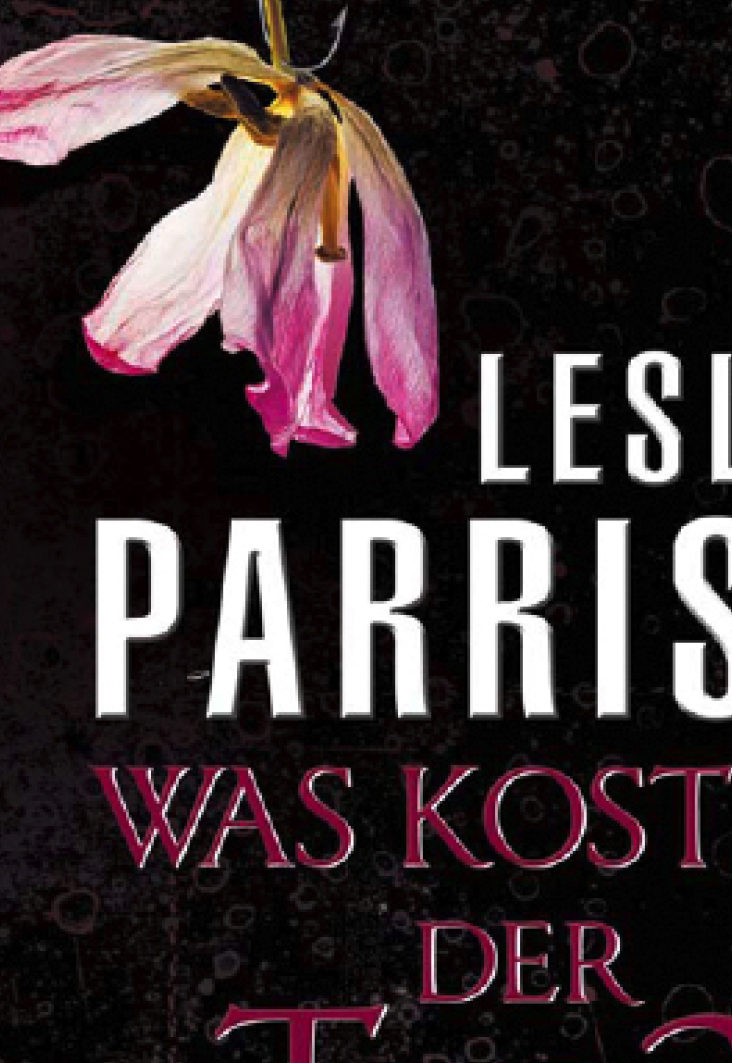![Black Cats 01. Was kostet der Tod]()
Black Cats 01. Was kostet der Tod
Nachdem sie dabei hatte zuschauen müssen, wie blutige Beweise aufgenommen wurden und Stan Freeds Gehirn vom Teppich gekratzt wurde, wollte sie ihm erwidern, dass er sich irrte. Und zwar gründlich.
Aber gleichzeitig war sie erstaunt über sich selbst. Denn es tat ihr zwar in der Seele weh, dass etwas so Abscheuliches in der Stadt geschehen war, in der sie groß geworden war. Andererseits konnte sie nicht leugnen, dass es sich gut anfühlte, mal wieder mit richtiger Polizeiarbeit zu tun zu haben. Sie spürte neue Energie durch ihre Adern fließen, und ihr Gehirn arbeitete so schnell und präzise wie schon lange nicht mehr. Die ganze Benommenheit, die träge, gelassene Haltung, die ihr noch vor gut einer Woche angehaftet hatte, war wie weggeblasen.
Das war nicht gut.
Warum fühlte sie sich auf einmal so lebendig?
»Gewaltsamer Tod«, murmelte sie, während sie am späten Abend ein letztes Mal durch das Haus der Freeds schlenderte. Ein so plötzlicher, gewaltsamer Tod ließ wohl jeden noch einmal darüber nachdenken, was er eigentlich gerade tat.
»Ich wäre dann so weit, wenn Sie auch fertig sind«, gab ihr der junge Kriminaltechniker Bescheid, der gerade seinen Spurensicherungskoffer zusammenpackte. Er ließ den Blick durch das Zimmer schweifen und schüttelte den Kopf. »Irgendjemand wird ganz schön zu tun haben, um hier sauber zu machen.«
Stacey trat auf ihn zu und schüttelte ihm die Hand. »Danke für Ihre Hilfe!«
»Nichts zu danken. Ich hoffe, das Ganze nimmt noch ein gutes Ende.«
Er hatte mehrere Stunden hier gearbeitet und dabei genug mitbekommen, um zu verstehen, was los war. Selbst Polizisten fiel es schwer, eine solche Situation wegzustecken. Schließlich setzte sich zwar jeder Bulle, den Stacey kannte, dafür ein, Verbrechen zu verhindern und aufzuklären. Aber sie hatten auch ein Herz. Und jeder, der auch nur einen Funken Menschlichkeit besaß, erkannte mit einem Blick, dass die fast bewusstlose und übel zugerichtete Winnie keine kaltblütige Mörderin war.
Jetzt wollte Stacey nur noch nach Hause fahren und duschen. Auf dem Weg zum Auto sah sie auf ihr Handy. Ein blinkendes Symbol zeigte an, dass sie eine Nachricht erhalten hatte. Sie wählte die Nummer ihres Anrufbeantworters, um ihn abzuhören, und vermutete, dass Dean ihr etwas auf Band gesprochen hatte. Stattdessen erklang die Stimme ihres Vaters.
»Stacey, ich hab gehört, was passiert ist, und ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber … « Seine Stimme schlug um, und Stacey hätte schwören können, dass sie ein Schniefen gehört hatte. Wahrscheinlich brachte ihn der Gedanke an die arme Winnie und ihre bedauernswerte Tochter aus der Fassung. »Du musst unbedingt herkommen, sobald du diese Nachricht erhalten hast.«
Das klang nicht gut.
»Und ich glaube, du kommst besser allein.«
Das klang ganz und gar nicht gut.
»Ich habe mir die Videos angesehen, und ich habe was gefunden. Bitte, komm einfach her!«
»Guter Gott, was denn nun noch?«, fragte sie sich laut, während sie ins Auto stieg und losfuhr. War es wirklich erst sieben oder acht Stunden her, dass sie bei ihm überhastet aufgebrochen und direkt hierhergekommen war – in der Überzeugung, Winnie tot auf dem Boden vorzufinden?
Wie leicht das Leben doch aus den Fugen geriet! Und es war so verdammt unberechenbar. In großen Städten, an großen Universitäten – und hier.
Sie schob diesen Gedanken beiseite, um sich später damit auseinanderzusetzen.
Als sie bei ihrem Vater ankam, entdeckte sie ihn auf der Veranda, wo er bereits auf sie wartete. Gleich nachdem sie angehalten hatte, war er aus der Tür getreten. Offensichtlich hatte er nach ihr Ausschau gehalten.
»Ich habe deine Scheinwerfer in der Einfahrt gesehen«, rief er.
Stacey stieg aus und bewegte den Kopf erst nach rechts, dann nach links, um ein wenig ihren schmerzenden Nacken zu dehnen. Erst als sie die Eingangstreppe erreicht hatte und in den Lichtkegel trat, den die Lampe an der Haustür warf, bemerkte sie, dass Stans Blut an ihrer Uniform klebte. Ihr Vater sah es, erbleichte ein wenig und winkte sie dann herein.
»Was ist los?«
Er führte sie in die Küche. Auf dem Tisch leuchtete immer noch der Laptop. Daneben stand ein halb aufgegessener Teller mit Spaghetti. Und ein fast leeres Glas mit Whiskey.
Dad trank sehr selten Alkohol. Und niemals allein. Angst lag in ihrer Stimme, als sie etwas lauter wiederholte: »Was ist denn los?«
Er antwortete nicht. Stattdessen setzte er sich hin, drehte den
Weitere Kostenlose Bücher