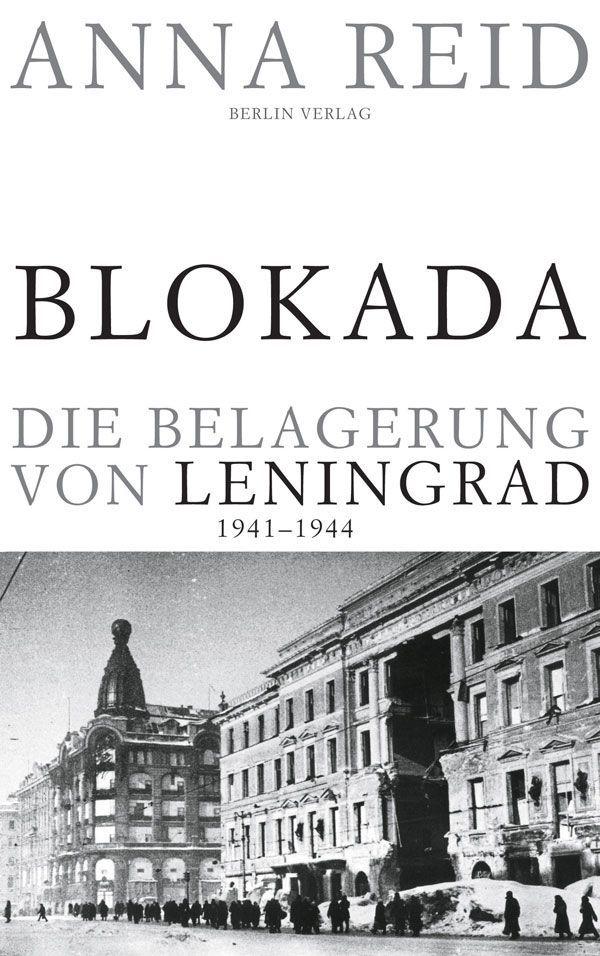![Blokada: Die Belagerung von Leningrad, 1941-1944 (German Edition)]()
Blokada: Die Belagerung von Leningrad, 1941-1944 (German Edition)
Der Gefallen, den er der Familie Gretschin schuldete, ging zurück bis ins Jahr 1916, als man ihn dabei erwischte, wie er »Selbstverstümmler« – Soldaten, die sich in die linke Hand geschossen hatten, um als Invaliden aus der Armee auszuscheiden – in die Etappe schickte und dadurch vor der Hinrichtung rettete. Statt ihn anzuzeigen, hatte Olgas Vater die Hände der Soldaten neu vernäht, um die Wunden zu verbergen, und ihn in ein anderes Krankenhaus versetzt. Mittlerweile arbeitete Michailow in der Nähe der Gretschins in einer Kellerklinik an der Pestelja, einer anmutigen, italienisierten Straße mit zwei perfekt proportionierten neoklassischen Kirchen an den Enden. Olga fand ihn
umringt von alten Frauen vor – jedenfalls sahen sie damals so aus. Auch er selbst schien plötzlich ein hohes Alter zu haben. Ich bat ihn, mitzukommen und Mama zu untersuchen, doch er weigerte sich mit den Worten: »Sie wissen, dass wir Hausbesuche nur unter ungewöhnlichen Umständen machen können, und sie ist bereits diagnostiziert und behandelt worden.« Ich war empört und wies ihn zurecht: Er sei in der humanitären Tradition ausgebildet worden und habe den hippokratischen Eid abgelegt – wie also könne er es ablehnen, eine kranke Person zu besuchen? Traurig ließ er mich aussprechen, bevor er antwortete: »Wenn ich zu Ihnen komme, werde ich nicht in der Lage sein heimzukehren. Für mich ist alles abgemessen: Einmal am Tag kann ich die Pestelja von der Tschaikowski-Straße aus erreichen. Ich habe nicht die Kraft, mehr zu tun. Und wenn ich nicht zur Arbeit erscheine, was soll dann aus all diesen Menschen werden?« Und er zeigte auf die Tür, hinter der seine Patienten warteten.
Ein anderer Arzt, den Olga im Voraus für einen Hausbesuch bezahlt hatte, riet ihr zuerst herzlos, ihre Mutter mit Hühnersuppe und Milch zu füttern, bevor er schließlich doch das Schlafzimmer verließ, um ein Rezept für Beruhigungsmittel auszuschreiben. Nachdem er sich verabschiedet hatte, bemerkte Olga, dass ein paar Bonbons aus einer Dose auf dem Küchentisch verschwunden waren.
Im November fanden Olga und Wowa Arbeit: Wowa als Heizer, was bedeutete, dass er Holz hacken und verladen musste, und Olga in einer Fabrik, die früher Vervielfältigungsgeräte hergestellt hatte und nun Munition lieferte. Dort überprüfte sie halb fertige Geschosshülsen und trug sie von einer Werkbank zur anderen. Die Hülsen waren schwer, ölig und mit Stahlspänen bedeckt, die ihr in die Hände schnitten, aber sie verdiente 230 Rubel pro Woche, durfte so viel Suppe (»eigentlich nur heißes Wasser«) trinken, wie sie wollte, und sogar einen Teil davon für ihre Mutter mit nach Hause nehmen. Ende des Monats erhielt die Familie ihre erste Todesnachricht: Leonid war in der Nähe des Dorfes gefallen, in dem Olga ihn ein paar Wochen vorher besucht hatte.
Anfang Dezember musste Olga wegen geschwollener Beine und infizierter Wunden an den Händen zu Hause bleiben, und sie hörte von Todesfällen bei Nachbarn in ihrem Wohnblock. Als Erste starben (wie überall in der Stadt) die Hilfskräfte von niedrigem Status: der Pförtner des Gebäudes – »ein sehr ordentlicher, ehrbarer Mann« – und seine Frau, dann der Hofarbeiter, danach ein »kleiner schnurrbärtiger und düsterer Rentner, der in der ersten Etage wohnte und sein Leben damit verbrachte, Jungen wegen Rowdytums nachzusetzen«. Als Nächstes waren die gewöhnlichen Mieter an der Reihe, zum Beispiel der Ehemann einer Sängerin, die mit ihrem geistig behinderten Sohn eine Etage über Olga wohnte:
An einem Dezemberabend, gegen 23 Uhr, klopfte jemand an die Tür. Ich öffnete, und vor mir stand unsere Nachbarin N mit einem kleinen Glas in der Hand. Sie sagte: »Mein Sohn liegt im Sterben – ich flehe Sie an, geben Sie mir einen Löffelvoll Sonnenblumenöl. Wenn ich es ihm in den Mund gieße, kann ich ihn vielleicht retten.«
»Aber ich habe kein Öl!«
»Doch, Sie haben es! Sie müssen meinen Sohn retten!«
Nein, beteuerte ich, aber in Wirklichkeit hatte ich 100 Gramm Öl, die ich mir zufällig irgendwo mit meiner Karte verschafft hatte. Doch ich konnte nichts davon für N entbehren, weil ich Mama damit fütterte. Wenn ich es N’s Sohn überließ (der mir immer zutiefst unsympathisch gewesen war), was sollte ich ihr dann geben? Ich wurde wütend über N, denn es war entsetzlich beschämend, ihre Bitte auszuschlagen, und sie ging davon. Am Morgen starb ihr Junge. Ich kam mir vor wie eine Mörderin. 7
Nicht nur
Weitere Kostenlose Bücher