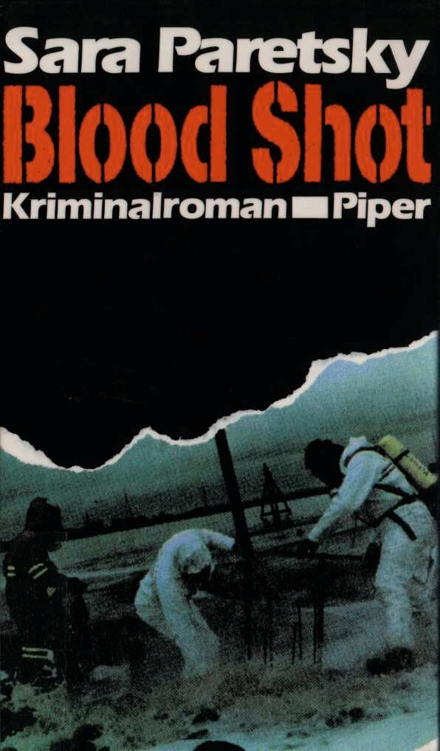![Blood Shot]()
Blood Shot
Ihnen keinen Kaffee anbieten - ich hole meinen immer im Cafe über der Straße.«
Zwischen seinen Schreibtisch und die Tür hatte er zwei Besucherstühle gequetscht. Wenn man sich in dem linken zurücklehnte, stieß man gegen einen Aktenschrank. Der rechts stand direkt an der Wand; eine Reihe grauer Stellen zeigte an, wo die Leute mit der Lehne an der Pappwand gescheuert hatten. Es tat mir leid, daß ich diesem Unternehmen nicht mit einem Auftrag und ein bißchen Bargeld unter die Arme greifen konnte.
Manheim nahm einen Notizblock zur Hand. »Würden Sie mir bitte Ihren Namen buchstabieren?«
Ich buchstabierte. »Ich bin Anwältin, Mr. Manheim, aber derzeit arbeite ich in erster Linie als Privatdetektivin. Bei einem Fall, in den ich verwickelt bin, bin ich auf zwei Ihrer Mandanten gestoßen. Frühere Mandanten. Joey Pankowski und Steve Ferraro.«
Durch seine dicken Brillengläser hatte er mich höflich betrachtet, den Kugelschreiber locker in der Hand. Als ich die Namen Pankowski und Ferraro erwähnte, ließ er den Kugelschreiber fallen und sah so besorgt aus, wie ein Mann mit rosigen Engelswangen nur aussehen konnte.
»Pankowski und Ferraro? Ich bin nicht sicher, daß -«
»Arbeiter bei den Humboldt-Werken, das heißt in diesem Fall Xerxes in South Chicago. Sie sind vor zwei oder drei Jahren gestorben.«
»Ach ja. Jetzt erinnere ich mich. Sie brauchten juristischen Beistand, aber ich fürchte, ich habe ihnen nicht sehr viel helfen können.« Hinter seinen Brillengläsern blinzelte er unglücklich.
»Ich weiß, daß Sie nicht gern über Ihre Mandanten sprechen, genausowenig wie ich über meine. Aber wenn ich Ihnen erkläre, warum ich mich für Pankowski und Ferraro interessiere, werden Sie mir dann ein paar Fragen beantworten?«
Er senkte den Kopf und spielte mit dem Kugelschreiber. »Ich - ich kann wirklich nichts -«
»Was war los mit den beiden? Jedesmal, wenn ich ihren Name erwähne, fangen erwachsenen Männern die Knie zu Schlottern an.«
Er blickte auf. »Für wen arbeiten Sie?«
»Für mich selbst.«
»Sie arbeiten nicht für irgendeine Firma?«
»Sie meinen, zum Beispiel für Humboldt? Nein. Ursprünglich hatte mich eine junge Frau engagiert, die ich seit meiner Kindheit kenne. Ich sollte ihren Vater für sie finden. Es gibt die vage Möglichkeit, daß einer der zwei - am wahrscheinlichsten Pankowski - in Frage kommt. Ich versuchte bei Xerxes jemanden aufzutreiben, der ihn kannte. Meine Auftraggeberin hat mich letzten Mittwoch gefeuert, aber meine Neugier ist angestachelt durch die Art und Weise, wie die Leute reagieren. Man hat mich angelogen, insbesondere was den Rechtsstreit zwischen Pankowski und Ferraro einerseits und Xerxes andererseits angeht. Und dann hat mir jemand vom Arbeitsministerium erzählt, daß Sie die beiden vertreten haben. Deswegen bin ich hier.«
Er lächelte unglücklich. »Vermutlich gibt es keinen Grund, warum nach so langer Zeit jemand von der Firma hier aufkreuzen sollte. Aber es fällt mir schwer zu glauben, daß Sie nur für sich selbst arbeiten. Zu viele Leute haben sich zu auffällig für den Fall interessiert, und jetzt schneien Sie einfach so aus heiterem Himmel herein? Das ist seltsam. Klingt zu einfach.«
Ich rieb mir die Stirn und versuchte, mir was einfallen zu lassen. Schließlich sagte ich: »Ich werde etwas tun, was ich während meiner ganzen Laufbahn als Privatdetektivin noch nie getan habe. Ich werde Ihnen haargenau erzählen, was vorgefallen ist. Wenn Sie mir danach noch nicht vertrauen, bin ich mit meinem Latein am Ende.«
Ich begann damit, wie die schwangere Louisa ein paar Monate vor meinem elften Geburtstag im Haus nebenan einzog. Erzählte von Ga-briella und ihrer verrückten Impulsivität, von Carolines überschwenglicher Menschenliebe auf Kosten anderer, davon, daß an mir immer noch das Gefühl nagte, ich sei etwas wie ihre ältere Schwester und für sie verantwortlich. Von Nancys Ende im Dead Stick Pond sagte ich nichts, aber ich beschrieb alle Vorfälle im Zusammenhang mit Xerxes, meine Unterhaltung mit Dr. Chigwell und schließlich auch Humboldts Eingreifen. Das war die einzige Episode, die ich schönte. Ich brachte es nicht über mich, ihm zu erzählen, wie der Firmenbesitzer mich mit seinem Cognac eingelullt hatte - es war mir peinlich, weil ich mich von seinem Reichtum hatte blenden lassen. Ich murmelte etwas vom Anruf eines stellvertretenden Direktors.
Nachdem ich geendet hatte, nahm Manheim die Brille ab, und es fand ein gründliches
Weitere Kostenlose Bücher