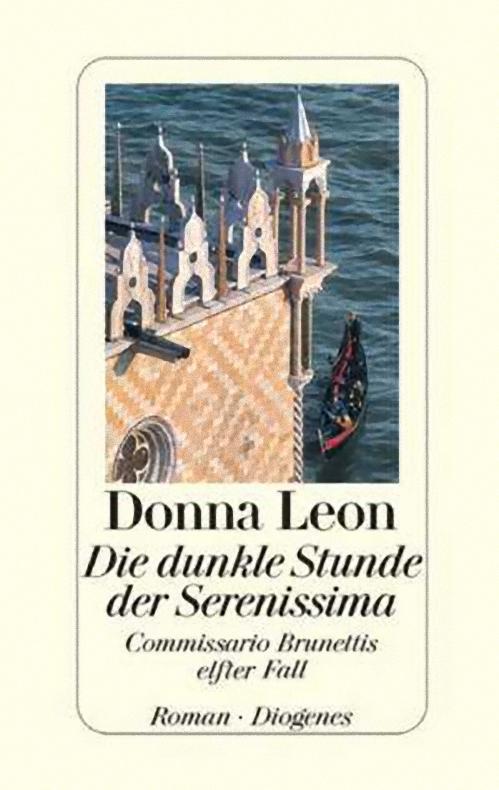![Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima]()
Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima
Gegenleistung von ihr fordern und ob sie darauf eingehen würde.
»Das sind ihre Briefe«, sagte Signorina Elettra und reichte ihm einen Stapel Papiere. »Die Daten und die angeführten Beträge stimmen mit den Abbuchungen von ihrem Konto überein.«
Brunetti las den ersten Brief, adressiert an ein Waisenhaus in Indien, in dem Claudia schrieb, ihre Spende solle den Kindern zu einem besseren Leben verhelfen, und dann einen an ein Heim für mißhandelte Frauen in Pavia, der ganz ähnlich formuliert war. In beiden Briefen stand, die Spende diene dem Andenken ihres Großvaters, dessen Name allerdings ebensowenig genannt wurde wie der ihre.
»Sind alle so?« fragte er, von dem Schreiben aufblickend.
»Ja, so ziemlich. Ihr Name oder der des Großvaters bleiben immer ungenannt, und jedesmal gibt sie der Hoffnung Ausdruck, der beigefügte Scheck möge den Empfängern zu einem besseren Leben verhelfen.«
Brunetti wog den Stapel Briefe in den Händen. »Wie viele sind's denn?« fragte er.
»Über vierzig. Alle im gleichen Tenor.«
»Und sind die Beträge auch immer gleich?«
»Nein, die variieren. Allerdings scheint sie eine Vorliebe für Zehn-Millionen-Lire-Spenden gehabt zu haben. Der Gesamtbetrag deckt sich annähernd mit der Summe, die im Lauf der Jahre auf ihr Konto geflossen ist.«
Brunetti überlegte, was für ein Vermögen eine dieser Spenden für ein indisches Waisenhaus oder ein Asyl für mißhandelte Frauen bedeuten mochte.
»Und gibt es auch Mehrfachspenden an irgendeinen Adressaten?«
»An das Waisenhaus in Kerala und an das AIDS-Hospiz. Die scheinen ihr besonders am Herzen gelegen zu haben; alles übrige sind, soweit ich es überblicken kann, einmalige Zuwendungen.«
»Was haben Sie sonst noch?« fragte er.
Signorina Elettra deutete auf den ihr zunächst liegenden Stapel. »Das sind die Referate, die sie für ihre Seminare geschrieben hat. Ich hatte noch nicht die Zeit, alle zu lesen, aber daß Gilbert Osmond ihr zuwider war, ist nicht zu übersehen.«
Den Namen hatte er oft genug von Paola gehört, um zu wissen, daß sie Claudias Abneigung teilte. »Und sonst?« fragte er.
Signorina Elettra wies auf einen dicken Stapel neben ihrem Computer und sagte: »Privatkorrespondenz, ist aber nichts sonderlich Interessantes dabei.«
»Und das da?« fragte er und zeigte auf ein einzelnes Blatt.
»Zum Steinerweichen«, seufzte sie und reichte es ihm.
»Ich, Claudia Leonardo«, las er, »erkläre hiermit, daß mein gesamter Besitz bei meinem Tode verkauft und an die nachstehend aufgeführten karitativen Einrichtungen verteilt werden soll. Ich weiß wohl, daß eine solche Geste das Unrecht lebenslanger unrechtmäßiger Bereicherung nicht wiedergutmachen kann; dennoch bitte ich es als Versuch in diese Richtung anzuerkennen.« Darunter waren die Namen und Adressen von sechzehn Wohltätigkeitsorganisationen aufgeführt, zu denen auch die indischen Waisenhäuser und das Frauenhaus in Pavia gehörten.
»›Unrechtmäßige Bereicherung‹?« fragte er.
»Als sie starb, hatte sie drei Millionen, sechshunderttausend Lire auf der Bank«, antwortete Signorina Elettra lakonisch.
Brunetti las das Testament noch einmal und blieb wieder bei der Wendung »unrechtmäßige Bereicherung« hängen. »Sie meint ihren Großvater!« rief er, als ihm endlich ein Licht aufging.
Signorina Elettra, der Vianello einiges aus Claudias Familiengeschichte erzählt hatte, schloß sich seiner Meinung an.
Dann bemerkte Brunetti, daß das Testament nicht unterschrieben war. »Ist das Ihr Computerausdruck?« fragte er.
»Ja.« Und bevor er weiterfragen konnte, setzte sie hinzu: »Bei ihren Papieren habe ich aber keine Kopie gefunden.«
»Verständlich. Wer so jung ist, glaubt nicht ernsthaft, daß er sterben muß.«
»Passiert normalerweise ja auch nicht«, ergänzte Signorina Elettra.
Brunetti legte das Testament auf den Schreibtisch zurück. »Was haben Sie unter der Privatkorrespondenz gefunden?«
»Briefe an Freunde und ehemalige Klassenkameraden, an eine Tante in England. Letztere auf englisch. Sie schrieb über ihren Alltag, ihr Studium, erkundigte sich nach den Kindern der Tante und nach den Tieren auf dem Hof. Ich glaube nicht, daß es was bringt, aber wenn Sie wollen, können Sie gern reinschauen.«
»Nein, nein, schon gut. Ich verlasse mich da ganz auf Sie. Hatte sie sonst noch Korrespondenz?«
»Nur den üblichen Behördenkram: vor allem mit der Universität, ach ja, und dann war da noch ein Schrieb, der aussah wie der
Weitere Kostenlose Bücher