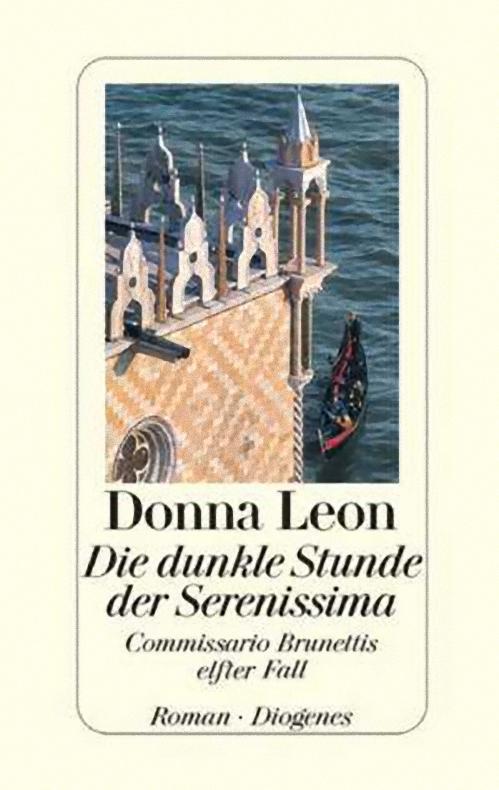![Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima]()
Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima
die Antwort erst abwägen, so hatte er sich geirrt, denn der Conte versetzte ohne zu zögern: »Nein, stolz bin ich nicht darauf. Das heißt, anfangs war ich's vermutlich schon, aber da war ich sehr jung, noch gar nicht richtig erwachsen. Ich war keine achtzehn, als der Krieg zu Ende ging, trotzdem hatte ich da schon über zwei Jahre gelebt und gehandelt wie ein Mann, oder wie ich mir vorstellte, daß ein Mann handeln müsse. Doch mein moralisches Bewußtsein«, hier hielt der Conte inne und schenkte Brunetti ein Lächeln, das seltsam anrührend wirkte, »oder, wenn du so willst, meine ethische Reife war die eines Knaben.«
Er beugte sich nieder, als studiere er das Muster des Teppichs zu seinen Füßen, und schnippte ein paar zerzauste Fransen wieder gerade, was Brunetti daran erinnerte, wie er die tote Claudia Leonardo vorgefunden hatte. Die Stimme des Conte holte ihn in die Gegenwart zurück. »Niemand sollte stolz darauf sein, einen Menschen getötet zu haben, schon gar nicht solche wie die, die wir kurz vor dem Ende exekutierten.« Fast beschwörend, als wolle er ihn zwingen zu verstehen, sah er zu Brunetti auf. »Wir kennen vermutlich alle das Klischee vom deutschen Wehrmachtssoldaten: ein blonder Hüne, womöglich noch mit dem Totenkopf als Elite-Abzeichen einer Spezialeinheit dekoriert, wie er das Blut von seinem Bajonett wischt, nachdem er - was weiß ich - einer Nonne oder einer Mutter die Kehle durchbohrt hat. Die Männer, mit denen ich zusammen war, sagten, zu Anfang hätten sie solche Greueltaten erlebt, aber am Ende hatten wir es bloß noch mit verängstigten Kindern zu tun, die statt in Uniformen in irgendeiner notdürftig zusammengewürfelten Kluft herumliefen, sich an ihren Waffen festklammerten und hofften, der Umstand, daß sie welche trugen, mache aus ihrem kläglichen Trupp eine richtige Armee. Dabei waren es nichts als Kinder, die Todesangst hatten, genau wie wir.« Er nippte an seinem Grappa und drehte dann das Glas zwischen den Händen. »Ich erinnere mich an einen der letzten, die wir getötet haben.« Seine Stimme war ruhig und sachlich, als wolle er das, was er erzählte, auf Distanz halten. »Er kann höchstens sechzehn gewesen sein. Wir nahmen ihn gefangen und brachten ihn vors Kriegsgericht, jedenfalls nannten wir es so. Aber das Verfahren lief ganz nach der Devise, die man aus amerikanischen Western kennt: ›Macht ihm einen fairen Prozeß, und dann wird er gehenkt.‹ Nur daß wir ihn erschossen. Oh, wir nahmen uns enorm wichtig, spielten Anwälte und Richter und kamen uns dabei furchtbar heldenhaft vor. Er war, wie gesagt, noch ein halbes Kind, völlig hilflos, und es gab keinen Grund, warum wir ihn nicht einfach hätten gefangensetzen sollen. Eine Woche später kapitulierten die Deutschen. Aber da war er schon tot.«
Der Conte wandte sich ab und sah zum Fenster. Vom anderen Ufer des Canal Grande schimmerten verzerrte Lichter herüber, und auf die richtete sich im Weitersprechen sein Blick. »Zwar gehörte ich nicht zum Erschießungskommando, aber ich mußte ihn an die Wand führen und ihm die Augen verbinden. Sicher hatte das einer von uns in einem Buch gelesen oder im Kino gesehen. Ich hätte es schon damals besser gefunden, die Verurteilten sehen zu lassen, wer sie töten würde. So viel stand ihnen zu. Oder so wenig. Aber vielleicht taten wir es genau deswegen, damit sie uns nicht sehen konnten.«
Er machte eine lange Pause, wie um die eigene Einschätzung zu überprüfen, und fuhr dann fort: »Er hatte panische Angst. Kaum, daß ich hochlangte, um ihm die Augen zu verbinden, versagte seine Blase. In dem Augenblick hatte ich kein Mitleid mit ihm; wahrscheinlich fand ich es sogar gut, daß wir diesen Deutschen zu so einem erbärmlichen Häuflein Elend erniedrigt hatten. Es wäre barmherziger gewesen, über seine Schmach hinwegzusehen, aber damals kannten wir keine Barmherzigkeit, ich nicht und die anderen auch nicht. Also starrte ich hinunter auf den Fleck in seiner Hose, und er sah genau, wo ich hinschaute. Dann fing er an zu weinen, und ich konnte genug Deutsch, um zu verstehen, was er sagte: ›lch will zu meiner Mutter. Ich will zu meiner Mutter‹, und er konnte nicht aufhören zu schluchzen. Er hielt das Kinn auf die Brust gepreßt, und ich kriegte das Tuch nicht über seine Augen, also trat ich einfach zur Seite, und sie erschossen ihn. Vielleicht hätte ich ihm mit dem Tuch die Tränen abwischen können, aber wie gesagt, ich war sehr jung damals und kannte keine
Weitere Kostenlose Bücher