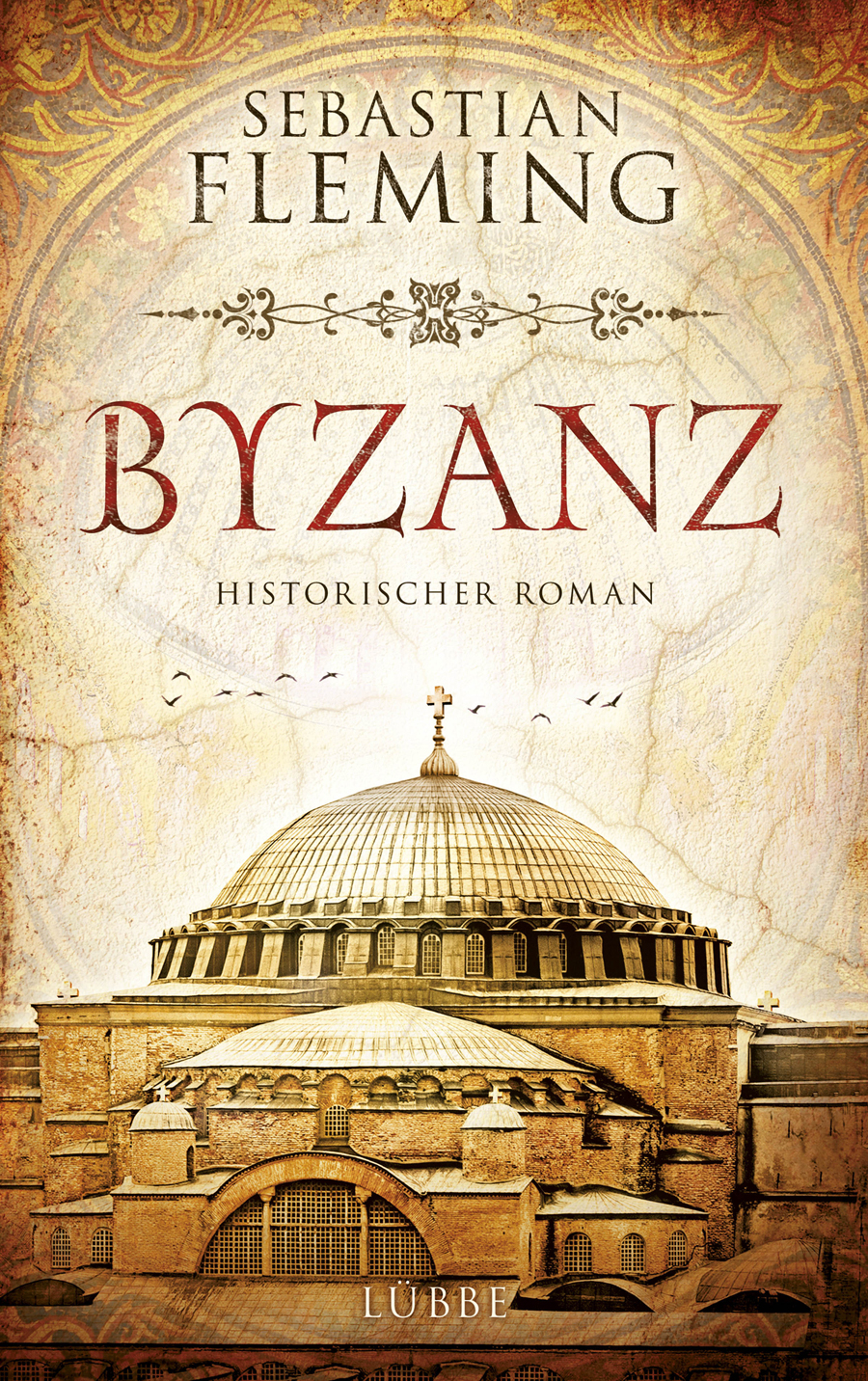![Byzanz]()
Byzanz
1
Auf dem Meer Propontis vor Konstantinopel
Das Meer roch kräftig nach Leben. Nach Fisch, Plankton und Salz. Aus den Wassern stieg – anfangs noch zaghaft, dann immer selbstbewusster – die Hagia Sophia und in ihrem Gefolge die Kirchen, Paläste und Wohnhäuser, die sie regierte wie der Kaiser Manuel Palaiologos seine Untertanen. Herausfordernd durch ihre Schönheit, beherrschend durch ihren Stolz, glich Konstantinopel einer wahren Königin, begehrt von vielen, treu allein ihm. Loukas Notaras stand auf der Brücke seiner Galeere und genoss den Anblick. In seinem Nacken, den struppiges Haar überwucherte, spürte er, dass sich die Sonne langsam in den Westen zurückzog. Vom Norden kommend, begruben dunkle Wolken die Metropole unter ihrem Schatten. Ein kleiner Aufschrei lenkte die Aufmerksamkeit des Kapitäns zum Vordeck, auf dem die Gräfin Sophia von Montferrat inmitten ihrer Zofen mit dem Zeigefinger des ausgestreckten Armes auf das Unwetter wies, das sich zusammenbraute.
Die Ruderer griffen so eifrig in die Riemen, als wollten sie sich mit den fünf Delfinen messen, die backbord immer wieder durch die Lüfte glitten, bevor sie erneut für kurze Zeit in die See eintauchten. Möwen kämpften krächzend um die besten Plätze auf dem Mastbaum.
Der Wind, der dem Kapitän als leichte Brise ins Gesicht blies, stürzte ins Meer. Er fühlte eine Anwandlung von Mattigkeit. Die Möwen verstummten, und selbst die Gräfin schwieg. Nur das Ächzen des Schiffes und das Schlagen der Ruder kämpften mit tapferem Gleichmut gegen die unheimliche Stille. Die Delfine waren plötzlich verschwunden. Wie grauschwarzer Marmor lag das Meer vor dem Kapitän. Mit der rechten Hand wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Über Konstantinopel flatterten die Vögel orientierungslos umher.
»Segel einholen!«, befahl er.
Flink wie Eichhörnchen enterten die Matrosen den Mastbaum und refften die Segel. Nur zu gut wusste Loukas, dass sich der Sturm sammelte, und nach der Pause zu urteilen, war es ein furchtbarer Feind, der in wenigen Augenblicken über sie herfallen würde. Besorgt blickte er zur Takelage, aber die Mannschaft hatte ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt gerieten auch die Möwen in Panik.
»Ich übernehme das Steuer. Bring die Gräfin und die Zofen in die Kajüte«, befahl er einem großschädeligen Glatzkopf.
Loukas Notaras verspürte wenig Neigung, mit Sophia von Montferrat zu sprechen, und bedauerte Johannes Palaiologos, der schon bald mit dieser die Ehe und das Bett teilen würde. Sophia war klein und von gedrungener Gestalt, besaß aschfarbene Haare, ein pickeliges Maulwurfsgesicht mit groben Jochwulsten, die in Plusterwangen übergingen, und ausdruckslose gelbblaue Augen. Er mochte weder ihre Art noch ihr Aussehen. Die Gräfin kam dem Steuermann auf halbem Weg entgegen. Sie hörte ihn aber nicht an, sondern begab sich schimpfend in ihre Kajüte, als träfe den Seemann die Schuld am Wetter. Er folgte ihr mit einer gleichmütigen Miene, die eine große Geduld verriet. Wie einen Weckruf glaubte Loukas das Pfeifen einer einzelnen Böe zu vernehmen. Dann ging es los. Der Wind heulte wie ein Rudel Wölfe auf und trieb haselnussgroße Regentropfen vor sich her. Nach einer Weile kehrte Eudokimos zurück und spuckte aus. Der Kapitän fragte sich, ob die Geste des Steuermannes der Gräfin oder dem Sturm galt.
»Herr, es wird hart kommen«, sagte der Glatzköpfige.
»Wir stehen alle in Gottes Hand«, erwiderte Loukas äußerlich ungerührt, nur seine Fingernägel gruben sich in seine Handballen.
Mit neun Schwänzen, geflochten aus Regen und Wind, peitschte der Sturm das Gesicht des Kapitäns. Er hustete, er spuckte. Ans Steuer geklammert, um nicht weggeblasen zu werden, hielt Loukas Kurs auf die ewige Nacht. Die Lage der Stadt konnte er nur noch erahnen. Nicht einmal ein schwaches Blinken von den Leuchttürmen drang zu ihm. Verloren in der tobenden See wankte die Galeere, sie ächzte und krängte.
Der Kapitän wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Eudokimos schlug vor, nach Chalkedon abzudrehen, um dort im Hafen den Orkan abzuwarten, aber Loukas entschied sich dagegen. Er wusste, dass die Ruderer unter Deck den Sturm nur spürten. Ihre stillen und halblauten Gebete hallten in seiner Seele wider. Wenn unter ihnen Panik ausbrechen würde, dann wären sie verloren. Solange das Schiff manövrierfähig war, bestand noch Hoffnung. Der Kapitän setzte auf die Erfahrung der Besatzung und vertraute auf ihre Vernunft.
Den Plan, in
Weitere Kostenlose Bücher