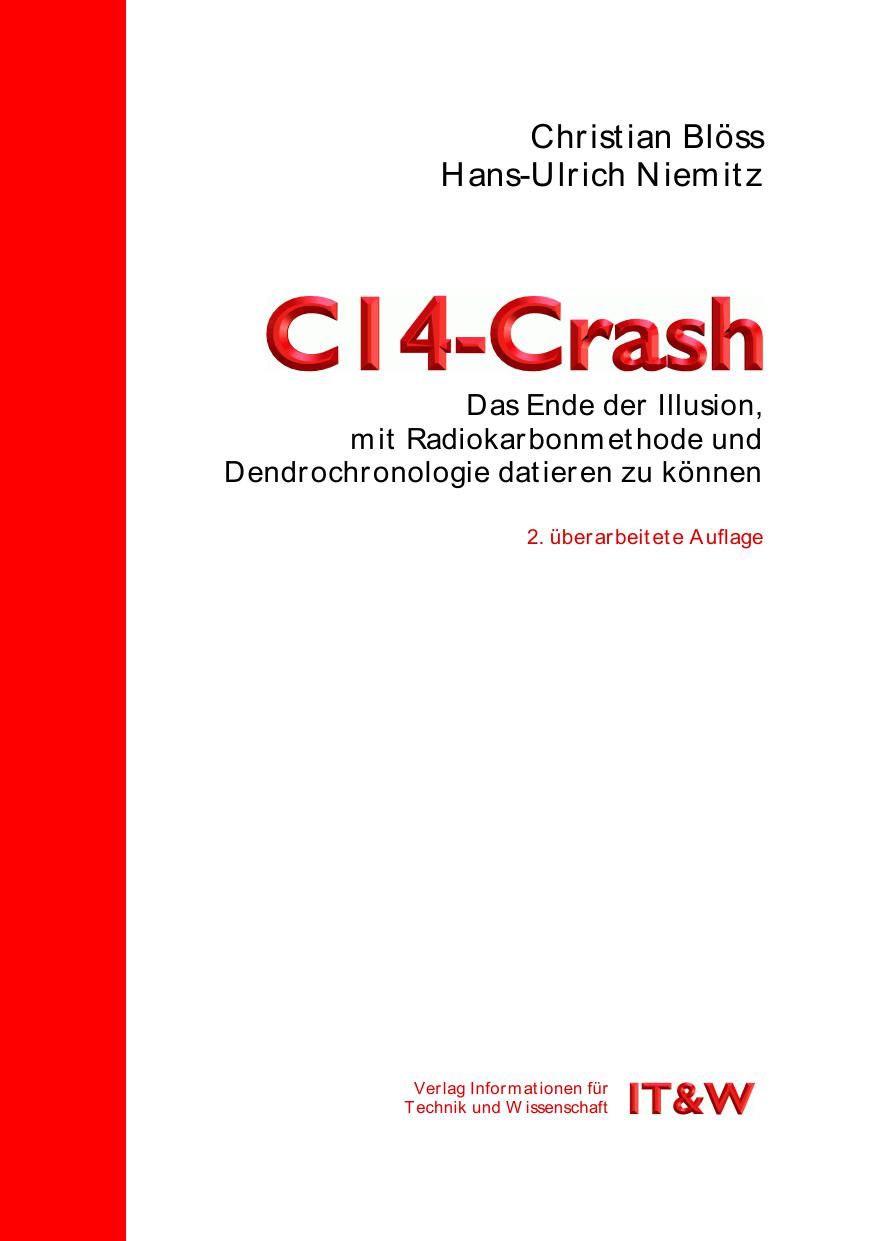![C14-Crash]()
C14-Crash
ohne sich Rechenschaft über die Zulässigkeit einer
solchen Aussage zu machen, denn die Atmosphäre war und ist Teil eines dy-
namischen, wandelbaren Ökosystems und von daher alles andere als stationär.
6.3 An der Wiege der C14-Methode
Wir hatten am Anfang dieses Kapitels die Rolle der Medizin bzw. der Medi-
zintechnik für die Kernphysik im allgemeinen und für die C14-Methode im
Besonderen hervorgehoben. Die Bedeutung von Kohlenstoff für den Stoff-
wechsel nahezu jeder Lebensform führte zu einer eingehenden Beschäftigung
mit den Isotopen des Kohlenstoffs. Einer der außergewöhnlichsten Begleit-
umstände in der Entwicklungsgeschichte der C14-Methode habe darin bestan-
den, so J.G. Ogden, daß man C14 im Labor herzustellen begann, ohne von
seiner Existenz in der Natur zu wissen [Ogden 1977, 167].
1934 wurde das erste Mal die Möglichkeit erwogen, daß radioaktiver
Kohlenstoff mit zwei zusätzlichen Neutronen entstehen könnte. (Für eine Zu-
sammenstellung wichtiger Ereignisse im Rahmen der atomphysikalischen
Vorarbeiten für die C14-Methode vergleiche das Bild 6.5 ) F.N.D. Kurie war
der erste, der mit Stickstoff N14 als möglicher Ausgangssubstanz für die Um-
wandlung in C14 experimentierte. Bei dem Beschuß von Stickstoff mit
schnellen Neutronen waren gelegentlich Kollisionsprodukte in der Nebelkam-
mer zu beobachten gewesen – lange dünne Spuren –, die am ehesten als Pro-
tonen gedeutet werden konnten. Danach wäre ein Elektron im Kern verblie-
ben und hätte sich mit einem Proton zu einem Neutron vereinigt bzw. hätte
ein Neutron den Platz eines Protons eingenommen.
Dieser Gedanke war ungewöhnlich, da bis dahin als Produkte im Zusam-
menhang mit Kernreaktionen nur α-Teilchen (zweifach positiv geladene Heli-
umkerne) geläufig waren. Die Vermutung von Kurie wurde wenig später von
W. Chadwick und M. Goldhaber bestätigt, die zeigten, daß das beim Beschuß
von Stickstoff N14 mit langsamen Neutronen ausgestoßene Partikel kein α-
Teilchen sein konnte (was eine Änderung der Anzahl der Teilchen im Kern
bedeutet hätte) und daß demzufolge bei dieser Umwandlung von Stickstoff
6.5
N14 das Kohlenstoffisotop C14 (mit genauso vielen Teilchen im Kern wie
Stickstoff) als wahrscheinlichster Kandidat für das Folgeprodukt anzusehen
war. Noch 1936 schlug der Versuch von C. Ruben fehl, C14 durch den Be-
220
C14-Crash
schuß von Stickstoffnitrat mit Hilfe des gerade fertiggestellten 27-Inch-Zy-
klotrons nachzuweisen [Taylor 1987, 149]. Ein anderes Experiment von McMil-
len mit Ammoniumnitrat wurde abgebrochen, nachdem ein Unfall den Pro-
benbehälter zerstört hatte [Kamen 1963, 586]. Jede weitere Arbeit über radioakti-
ven Kohlenstoff ruhte danach bis 1939.
Man ging von einer sehr kurzen Halbwertszeit des radioaktiven Isotops
C14 aus – einige Stunden bis Tage – und vermutete, daß vor allem die Kolli-
sion von C13 (etwa 1% Anteil am Gesamtkohlenstoff) mit Deuteronen (Kern
des »schweren« Wasserstoffs, bestehend aus je einem Proton und einem Neu-
tron) eine C14-Ausbeute erbringen würde. Wenn es überhaupt einen natürli-
chen Prozeß der Erzeugung von C14 geben sollte, dann müßte die Halbwerts-
zeit ohnehin sehr kurz sein. Eine Anreicherung schien jedenfalls nicht stattzu-
finden, da das C14 in der Natur einfach nicht nachzuweisen war. Die Medizin
suchte ohnehin vor allem nach Isotopen mit relativ kurzen Halbwertszeiten,
und künstlich hergestellte Isotope waren eher für kurze als für lange Halb-
wertszeiten bekannt [Kamen 1963, 586]. Das gilt auch für die ausschließlich
künstlich produzierten Isotope C10, C11 und C15. Das führte in den Anfän-
gen der Erprobung des kurzlebigen C11 – das Isotop hat eine Halbwertszeit
von lediglich 20 Minuten – zu teils sehr obskuren Überlegungen, wie der Tra-
cer im dichten Autoverkehr schnell genug von der Produktionsstätte zum Ein-
satzort gelangen könnte. Die Überlegungen reichten vom Einsatz einer Poli-
zeieskorte bis zur Verwendung von Brieftauben [Kamen 1964, 588].
1939 wurde, ausgelöst durch eine Debatte über die praktische Bedeutung
radioaktiver Isotope in der biomedizinischen Forschung, erneut gezielt nach
radioaktiven Isotopen für die biologisch bedeutsamen Elemente – also Was-
serstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff – gefahndet. M. Kamen und
C. Ruben wurden auf den radioaktiven Kohlenstoff angesetzt. Sie setzten ei-
ne Graphitprobe einer Deuteronenstrahlung aus und
Weitere Kostenlose Bücher