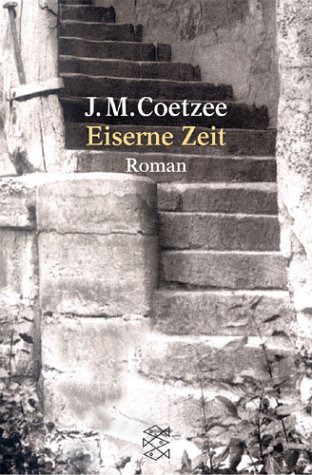![Coetzee, J. M.]()
Coetzee, J. M.
ihm. Er
nahm die Hände aus der Schüssel. Es roch nach einem Desinfektionsmittel.
»Ist es
schlimm?« sagte ich.
Er streckte die Hände vor,
die Handflächen nach oben.
Noch immer
sickerte Blut aus dem rohen Fleisch. Wunden der Ehre? Würden diese Wunden auf
der Liste als Wunden der Ehre zählen? Zusammen betrachteten wir die blutenden
Hände. Ich hatte den Eindruck, daß er Tränen zurückhielt. Ein Kind, nichts als
ein Kind, beim Spielen, auf einem Fahrrad.
»Dein
Freund«, sagte ich – »Meinst du nicht, seine Eltern sollten benachrichtigt
werden?«
»Ich kann sie anrufen«,
sagte Florence.
Florence
telefonierte. Ein langes, lautes Gespräch. »Woodstock-Krankenhaus«, hörte ich.
Stunden später kam ein
Anruf aus einer Telefonzelle, eine Frau, die Florence verlangte.
»Er ist nicht in dem
Krankenhaus«, berichtete Florence.
»War das
seine Mutter?« fragte ich.
»Seine Oma.«
Ich rief
das Woodstock-Krankenhaus an. »Sie werden seinen Namen nicht haben, er war
bewußtlos, als sie ihn mitnahmen«, sagte ich.
»Hier ist kein solcher
Patient verzeichnet«, sagte der Mann.
»Er hatte
eine schrecklich klaffende Wunde auf der Stirn.«
»Nichts verzeichnet«,
wiederholte er. Ich gab auf.
»Sie arbeiten mit der
Polizei zusammen«, sagte Bheki. »Alles dieselbe Sorte, Rettungsfahrer, Ärzte,
Polizei.«
»Das ist
Unsinn«, sagte ich.
»Keiner
traut den Rettungsfahrern mehr. Sie haben Sprechfunkverbindung mit der
Polizei.«
»Unsinn.«
Er lächelte ohne Charme und
genoß die Gelegenheit, mich zu belehren, mir etwas vom wahren Leben zu
erzählen.
Ich, die
Alte, die in einem Schuh wohnte, die keine Kinder hatte und nicht wußte, was
sie tun sollte. »Es ist wahr«, sagte er – »wenn Sie wollen, können Sie’s selber
hören.«
»Warum ist die Polizei
hinter dir her?«
»Sie ist
nicht hinter mir her. Sie ist hinter allen her. Ich habe nichts getan. Aber
wenn sie wen sehen, von dem sie denken, er sollte in der Schule sein, den
versuchen sie zu kriegen. Wir machen nichts, wir sagen bloß, wir gehn nicht zur
Schule. Jetzt kommen sie uns mit diesem Terror. Das sind Terroristen.«
»Und warum wollt ihr nicht
zur Schule gehn?«
»Wozu ist
die Schule da? Damit wir uns hübsch einfügen in das System der Apartheid.«
Kopfschüttelnd
wandte ich mich Florence zu. Ein kritisches kleines Lächeln lag auf ihren
Lippen, und sie zeigte es unverhohlen. Ihr Sohn gewann mühelos. Nun, sollte er.
»Ich bin zu alt dafür«, sagte ich zu ihr. »Aber es kann doch unmöglich in
deinem Sinne sein, daß dein Sohn sich auf der Straße herumtreibt und die Zeit
totschlägt, bis die Apartheid zu einem Ende kommt. Die Apartheid wird nicht
morgen oder übermorgen sterben. Er ruiniert sich die Zukunft.«
»Was ist
wichtiger, daß die Apartheid zerschlagen werden muß, oder daß ich zur Schule
gehen muß?« fragte Bheki, mich herausfordernd, Sieg witternd.
»So kann
man doch nicht fragen«, antwortete ich müde. Aber hatte ich recht? Wenn man so
nicht fragen konnte, wie dann? »Ich kann euch nach Woodstock bringen«, bot ich
an. »Aber dann müssen wir sofort los.«
Als Florence Vercueil in
Bereitschaft sah, wurde sie ärgerlich. Aber ich bestand darauf: »Er muß mit,
für den Fall, daß der Wagen streikt.«
Ich fuhr
sie also nach Woodstock, Vercueil neben mir, übler riechend denn je, irgendwie
auch unglücklich riechend, und Florence und Bheki schweigend auf dem Rücksitz.
Der Wagen kroch mühsam die sanfte Steigung zum Krankenhaus hinauf;
ausnahmsweise hatte ich die Geistesgegenwart, ihn mit dem Kühler bergab zu
parken.
»Ich sag
Ihnen doch, so einen haben wir hier nicht«, sagte der Mann am Schalter. »Wenn
Sie mir nicht glauben, gehn Sie in der Station nachsehn.«
So erschöpft ich auch war,
ich ging hinter Florence und Bheki her durch die Männerstation. Es war die
Stunde der Siesta; von den Bäumen draußen riefen leise die Tauben. Wir sahen
keine schwarzen Jungen mit verbundenen Köpfen, nur alte weiße Männer in
Schlafanzügen, die leer an die Decke starrten, während ein Radio beruhigende
Musik spielte. Meine geheimen Brüder, dachte ich: hier gehör ich hin.
»Wenn sie
ihn nicht hier eingeliefert haben, wo könnten sie ihn sonst hingebracht haben?«
fragte ich am Schalter.
»Versuchen
Sie’s im Groote Schuur.«
Der
Parkplatz am Groote-Schuur-Krankenhaus war voll. Eine halbe Stunde standen wir
mit laufendem Motor vor dem Tor, Florence und ihr Sohn leise miteinander
sprechend, Vercueil leer vor sich hin
Weitere Kostenlose Bücher