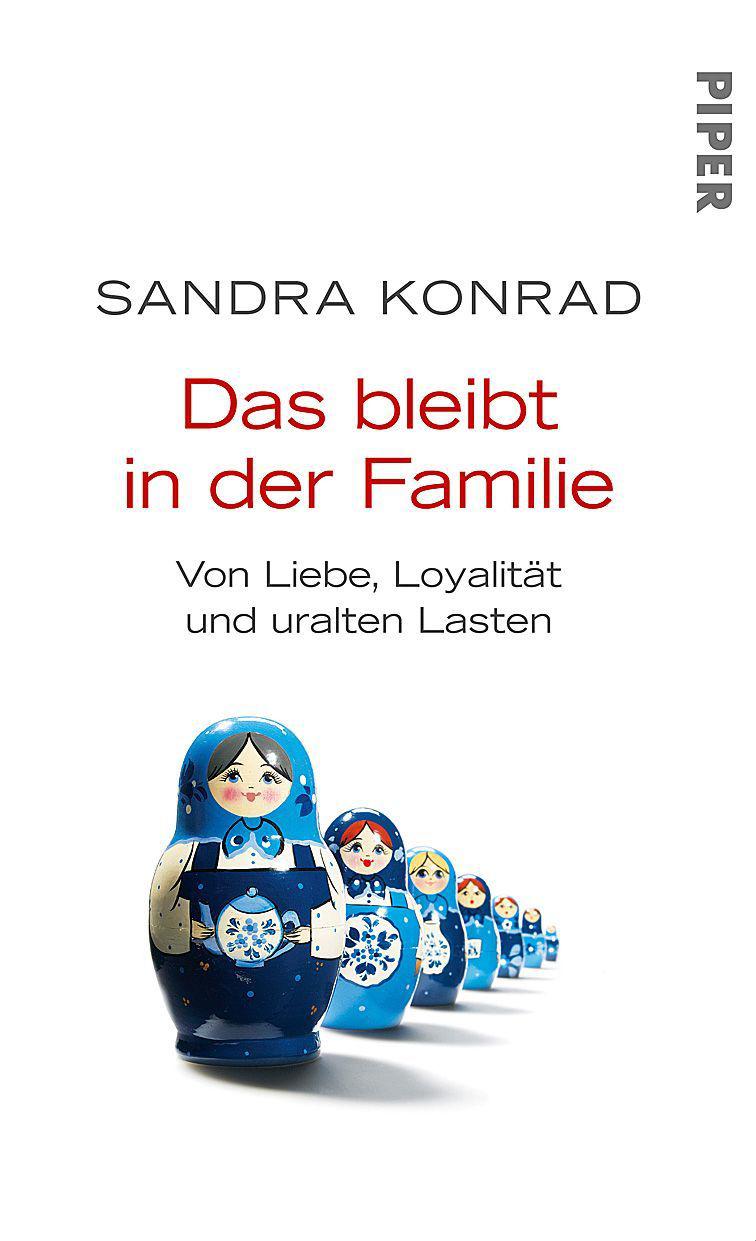![Das bleibt in der Familie: Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten (German Edition)]()
Das bleibt in der Familie: Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten (German Edition)
wie es vorher war. Nicht nur die Wahrnehmung der Welt und der anderen, auch das Traumaopfer selbst ist verändert, weil es die Erfahrung gemacht hat, ein hilfloses Objekt zu sein.
Traumatische Erfahrungen von Eltern schleichen sich in die Gefühlswelt ihrer Kinder ein, selbst wenn die Eltern nie darüber sprechen. Vor einigen Jahrzehnten entdeckten Therapeuten massive transgenerationale Traumaübertragungen bei den Kindern von Holocaust-Überlebenden, die seither therapeutisch und wissenschaftlich umfassend untersucht wurden.
Die transgenerationalen Auswirkungen des Holocaust
»Wie kann ich jemandem erklären,
dass mich eine Vergangenheit einholt,
die nicht meine ist, die die meiner
Eltern und unbekannter Verwandter ist?«
RALPH GIORDANO
Die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung hat bis heute Einfluss auf die Überlebenden und ihre Nachkommen: Heimatlosigkeit, Entwurzelung, Verlust des Vertrauens in die Welt und existenzielle Ängste ziehen sich wie ein roter Faden durch die Generationen. Das Urvertrauen ist in Überlebendenfamilien beschädigt, denn die grausamen Erfahrungen der ersten Generation sind auch für ihre Kinder und Kindeskinder der Referenzrahmen des Möglichen – wer einmal verfolgt wurde, kann wieder verfolgt werden.
Besonders die Kinder der Überlebenden, die Angehörigen der sogenannten zweiten Generation, litten unter den transgenerationalen Auswirkungen des Holocaust. Ihre Eltern hatten unvorstellbare Demütigungen und Qualen erlitten: Die Todesangst, die Entmenschlichung in den Lagern, der Verlust ihrer Familie und Freunde, ihres Zuhauses, jeglicher Sicherheit und Menschlichkeit prägten sie häufig für den Rest ihres Lebens. Jedes Gesetz, jede ethische Regel, jede emotionale Verlässlichkeit war im Dritten Reich aufgehoben worden, und auch nach der Befreiung war für die Überlebenden nichts mehr so, wie es einmal war.
Viele Überlebende waren schwer traumatisiert und versuchten dennoch, wieder Fuß zu fassen in einer Welt, die ihnen nicht mehr sicher erschien. Sie heirateten und gründeten Familien – jedes Kind ein Beweis für ihr Überleben. Obwohl sie meist schwiegen, um sich und ihre Umwelt zu schonen, obwohl sie in die Zukunft blicken wollten, holte die Vergangenheit sie immer wieder ein, denn: Traumatisierte sind mit einem Teil ihrer selbst an das Trauma gekettet und den dazugehörigen Erinnerungen und Gefühlen wie Angst, Ohnmacht und Wut hilflos ausgeliefert. Die traumatischen Erfahrungen ließen sich nicht verarbeiten, sie entzogen sich jeglichen Verständnisses, jeglicher Sprache, jeglicher Mitteilbarkeit. Der Schrecken jedoch blieb, er wurde wieder und wieder erlebt in plötzlichen Erinnerungen, in Albträumen, in einer unangenehm erhöhten Aufmerksamkeit und Ängstlichkeit.
Über Bindungserfahrungen übertrug sich das Trauma auch auf die Kinder der Überlebenden, die so in den »Vernichtungskosmos« ihrer Eltern hineingezogen wurden. Ein eindringliches Beispiel für die Weitergabe eines Traumas ist in Batyas Familie zu erkennen, deren Eltern den Holocaust in Arbeits- und Konzentrationslagern nur knapp überlebt hatten. Bei ihrer Befreiung wog Batyas Mutter Hella 28 Kilo, sie war mehr tot als lebendig. Hellas Mann erinnert sich an das Wiedersehen:
»Eines schönen Tages erschien Hella. Hella kam zurück! Hella war in schlechter Verfassung, seelisch und körperlich zerstört. Bis heute weiß ich nicht, was dieses zarte, sensible Mädchen durchmachen musste« (Sandra Konrad, Jeder hat seinen eigenen Holocaust ).
Wie viele Überlebende sprach Hella weder mit ihrem Mann noch mit ihren Kindern über ihre furchtbaren Erfahrungen:
»Wie erklärt man das Ärgste? Durchleben ist etwas anderes und erzählen ist etwas anderes. Wir sind Menschen ohne Namen, ohne gar nichts. Nur Nummern. Und – es ist schwer zu erzählen, aber es ist auch schwer zu verstehen.«
Hellas Tochter Batya berichtete mir viele Jahre später von ihrer frühen Kindheit, in der sie die Qualen der Mutter erspürte und in sich aufnahm.
»Ich aß nicht, ich weinte nicht, ich schrie nicht, ich habe mich nicht gerührt. Ich glaube, dass ich depressiv war. Ich glaube, dass ich die Depressionen meiner Mutter übernahm. Ich war immer sehr empfindsam für die Gefühle meiner Mutter.«
Batya beschreibt einen typischen Mechanismus, der häufig bei Kindern von schwer traumatisierten Eltern zu finden ist. Tatsächlich übernehmen Kinder die Gefühle ihrer Eltern, Gefühle, die für die Eltern so
Weitere Kostenlose Bücher