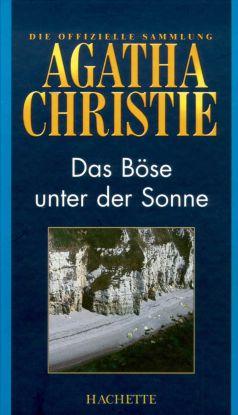![Das Böse unter der Sonne]()
Das Böse unter der Sonne
fröhlich und dankbar und beglückwünschten Poirot immer wieder zu seinem guten Einfall, einen solchen Ausflug zu veranstalten.
Während sie über die schmale gewundene Straße zurückfuhren, sank die Sonne. Von einem Hügel oberhalb der Bucht von Leathercombe konnten sie kurz die Insel mit dem weißen Hotel darauf sehen. Die Szene wirkte im Sonnenuntergang friedlich und unschuldig.
Mrs Gardener, die ausnahmsweise einmal geschwiegen hatte, seufzte und sagte: «Ich bin Ihnen ja so dankbar, Monsieur Poirot! Ich fühle mich so ruhig und entspannt. Es war einfach herrlich!»
Bei ihrer Ankunft kam ihnen Major Barry entgegen, um sie zu begrüßen. «Hallo!», rief er. «War der Ausflug schön?»
«Es war herrlich», erwiderte Mrs Gardener. «Das Moor war unglaublich schön. So englisch, genau wie man sich die ‹Alte Welt› vorstellt. Die Luft roch köstlich und würzig. Sie sollten sich schämen, dass Sie zu faul waren, mitzukommen.»
Der Major kicherte. «Ich bin zu alt für so was – im Sumpf zu sitzen und Brote zu essen.»
Ein Zimmermädchen kam aus dem Hotel gelaufen. Sie war etwas außer Atem. Sie zögerte einen Augenblick und ging dann rasch auf Christine Redfern zu.
Hercule Poirot erkannte sie. Es war Gladys Narracott. Sie rief mit aufgeregter Stimme: «Entschuldigen Sie, Madame, aber ich mache mir Sorgen um das junge Mädchen. Um Miss Marshall. Ich habe ihr eben Tee aufs Zimmer gebracht und konnte sie nicht wach bekommen. Sie sieht so – sie sieht irgendwie seltsam aus.»
Christine blickte sich Hilfe suchend um. Mit ein paar Schritten war Poirot neben ihr. Er schob seine Hand unter ihren Ellbogen und sagte ruhig: «Gehen wir hinauf, und sehen wir nach ihr.»
Sie eilten die Treppe hinauf, den Gang entlang zu Lindas Zimmer.
Ein Blick genügte, um zu wissen, dass etwas nicht stimmte. Lindas Gesicht hatte eine seltsame Farbe. Sie schien kaum noch zu atmen.
Poirot fühlte ihr den Puls. Im selben Augenblick entdeckte er das Kuvert, das an der Lampe auf dem Nachttisch lehnte. Es war an ihn adressiert.
Captain Marshall kam herein. «Was ist mit Linda los?», fragte er aufgeregt. «Was hat sie?»
Christine Redfern stieß ein leises, erschrecktes Schluchzen aus. Hercule Poirot wandte sich nach Marshall um und sagte: «Holen Sie einen Arzt! Beeilen Sie sich! Aber ich fürchte, ich fürchte sehr, dass es schon zu spät ist.»
Er nahm den Brief mit seinem Namen darauf und riss ihn auf. Darin steckte ein Blatt, das mit Lindas gerader Mädchenschrift bedeckt war. Sie schrieb:
« Ich glaube, dies ist der beste Ausweg. Bitten Sie meinen Vater, mir zu vergeben. Ich habe Arlena umgebracht. Ich dachte, dann wäre ich glüc k lich. Aber ich bin es nicht. Es tut mir schrecklich Leid. »
Sie waren alle in der Halle versammelt – Marshall, die Redferns, Rosamund Darnley und Hercule Poirot. Sie saßen schweigend da und warteten.
Dann öffnete sich die Tür, und Dr. Neasdon kam herein. «Ich habe mein möglichstes getan», sagte er kurz. «Vielleicht kommt sie durch. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass nicht viel Hoffnung besteht.» Er schwieg.
Marshalls Gesicht war wie erstarrt, seine blauen Augen waren eisig. «Wie ist sie an das Zeug rangekommen?», fragte er.
Neasdon öffnete die Tür und winkte jemandem. Ein Zimmermädchen trat ein. Sie hatte geweint.
«Würden Sie wiederholen, was Sie mir schon erzählt haben?», sagte Neasdon.
Das Zimmermädchen schnüffelte und sagte: «Ich dachte doch – nicht für einen Augenblick dachte ich, dass da etwas nicht stimmt. Obwohl das junge Mädchen sich ziemlich komisch benahm.» Der Arzt machte eine leicht ungeduldige Geste, und das Zimmermädchen nahm sich zusammen. «Sie war in Mrs Redferns Zimmer. In Ihrem Zimmer, Madame. Sie stand beim Waschbecken und nahm gerade ein Fläschchen aus dem Medizinschrank, als ich hereinkam. Sie zuckte zusammen, als sie mich sah, und ich fand es komisch, dass sie etwas aus Ihrem Zimmer holte, aber schließlich konnte es auch etwas sein, was sie Ihnen geliehen hatte. Sie sagte nur: ‹Ah, da ist es ja. Das habe ich gesucht›… und lief hinaus.»
«Meine Schlaftabletten», sagte Christine leise.
«Wieso wusste sie, dass Sie welche haben?», fragte der Arzt barsch.
«Ich gab ihr mal eine», antwortete Christine. «Am Abend nach dem Mord. Sie sagte, sie könne nicht schlafen. Ich erinnere mich noch, dass sie fragte, ob eine Tablette genügen werde. Und ich antwortete, dass sie sehr stark seien, dass man mich gewarnt habe, nie mehr
Weitere Kostenlose Bücher