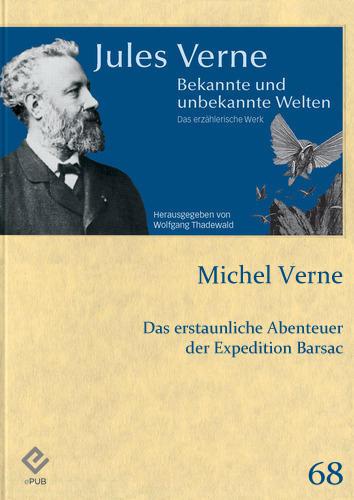![Das erstaunliche Abenteuer der Expedition Barsac]()
Das erstaunliche Abenteuer der Expedition Barsac
Männer der Eskorte ins Vertrauen zu ziehen, waren wir übereingekommen, bei der Bewachung einander abzulösen. Da wir sechs Mann sind, Mademoiselle Mornas eingerechnet, die ja Wert darauf legt, als Mann mitzuzählen, ist das im Grunde keine große Sache.
Unserem Programm entsprechend hat man die Nacht, das heißt die Zeit von neun Uhr abends bis fünf Uhr in der Frühe, in sechs gleiche Teile geteilt, und dann das Los gezogen. Aus der Wahlurne gehen wir in folgender Reihenfolge hervor: Mademoiselle Mornas, Monsieur Barsac, Hauptmann Marcenay, ich, Saint-Bérain und schließlich Monsieur Poncin. So hat es das Schicksal gewollt.
Um ein Uhr morgens ist es an mir, Hauptmann Marcenay abzulösen. Dieser sagt mir, alles sei in Ordnung, und zeigt mir im übrigen Moriliré, der in seinen ›doroké‹ eingerollt, nicht ferne von uns schläft. Da wir heute nacht gerade Vollmond haben, können wir deutlich das schwarze Gesicht dieses Schelms erkennen, das sich von der Weiße seiner Kleidung abhebt.
Während der Zeit meiner Wache trägt sich nichts Ungewöhnliches zu, und erst gegen halb zwei Uhr meine ich das gleiche Brummen zu vernehmen, das am Abend unseres ersten Tages hinter Kankan unsere Neugier in so hohem Maße erregt hat. Das Geräusch scheint von Osten zu kommen, ist aber diesmal so fern, so schwach, so ungreifbar, daß ich noch zu dieser Stunde nicht ganz sicher bin, es wirklich gehört zu haben.
Um viertel nach drei Uhr lasse ich mich von Saint-Bérain ablösen und lege mich nieder, kann jedoch nicht schlafen. Zweifellos liegt es an mangelnder Übung, daß der einmal unterbrochene Schlummer sich nicht wieder einstellen will. Nach einer halben Stunde vergeblichen Bemühens verzichte ich darauf und erhebe mich in der Absicht, den Rest der Nacht im Freien zuzubringen.
In diesem Augenblick höre ich von neuem – diesmal so schwach, daß ich an einen zweiten Trug der Sinne glauben könnte – das gleiche Brummgeräusch, das kurz zuvor meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Diesmal möchte ich Gewißheit haben. Ich eile vor den Eingang meines Zeltes und spitze die Ohren.
Nichts ist festzustellen, oder jedenfalls doch nur sehr, sehr wenig! Ein Summen, das in unmerklichen Abstufungen sich in östlicher Richtung verliert und dann erstirbt. Ich muß mich darein ergeben, den Zweifel nicht zu beheben.
Ich beschließe, mich nach Saint-Bérain umzusehen, der ja nun seine Runde machen muß.
Zu meinem Staunen jedoch – (staune ich eigentlich wirklich?) finde ich Saint-Bérain nicht auf seinem Posten vor. Ich möchte wetten, dieser unverbesserliche Zerstreute hat seinen Wachdienst vergessen und befaßt sich mit etwas ganz anderem. Hoffentlich hat Moriliré sich nicht die Situation zunutze gemacht, um sich auf französisch zu empfehlen!
Ich gehe der Sache nach. Nein, Moriliré ist nicht davongelaufen. Er liegt immer noch friedlich schlafend da, diesmal auf dem Bauch. Ich sehe sein schwarzes Gesicht und seinen hell im Mondschein leuchtenden weißen ›doroké‹.
Nach dieser Seite hin beruhigt, mache ich mich auf die Suche nach Saint-Bérain – in der Absicht, ihm gehörig die Wahrheit zu sagen. Ich kann mir ungefähr denken, wo ich ihn finden werde, denn ich habe festgestellt, daß nicht weit von unserem Lager entfernt ein Fluß vorüberrauscht. Ich gehe geradenwegs darauf zu und erkenne, wie vorauszusehen, einen Schatten mitten in der Strömung. Wie hat denn dieser engagierte Angler sich so weit vom Ufer entfernen können? Hat er etwa die Gabe, auf dem Wasser zu wandeln?
Wie er mir am nächsten Morgen erzählte, hatte Saint-Bérain sich ganz einfach aus drei Holzteilen ein improvisiertes Floß gezimmert, das gerade groß genug war, um ihn zu tragen, und sich dann mit einem langen Ast anstelle eines Ruders ein paar Meter vom Ufer abgestoßen. Dort hat er mit Hilfe eines durch ein Palmfaserseil mit dem Floß verbundenen großen Steins, der die Rolle des Ankers spielte, festgemacht. Die Herstellung dieser Hilfsmittel hatte ihn nicht mehr als eine halbe Stunde Arbeitszeit gekostet. Wirklich sehr einfallsreich.
Im Augenblick freilich ist es das nicht eben, was mich interessiert.
Ich trete dicht ans Ufer und rufe ihn mit gedämpfter Stimme an: »Saint-Bérain?«
»Hier!« antwortet der Schatten von den Wassern her.
»Was machen Sie denn da, Saint-Bérain?« fahre ich fort.
Ich höre leises Lachen, dann antwortet der Schatten:
»Ich bin beim Wildern, mein Lieber.«
Ich meine nicht recht gehört zu haben. Wildern? … Im
Weitere Kostenlose Bücher