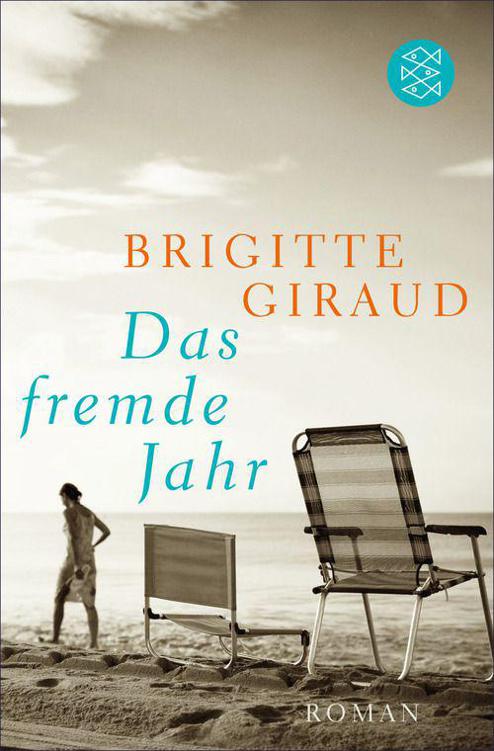![Das fremde Jahr (German Edition)]()
Das fremde Jahr (German Edition)
den Stuhl, vor den Kalender, der an einem Nagel an der Wand hängt, und lasse mir die Monatsnamen auf Deutsch durch den Kopf gehen: Januar, Februar, März, die Monate mit Schnee, Dunkelheit und Kälte, und ich weiß nicht, wie ich die Jahreszeiten überbrücke, bis mein Aufenthalt zu Ende ist, und wie ich sein werde, wenn der Sommer endlich da ist. Ich betrachte die Fotos auf dem Kalender, und alles kommt mir sonderbar vor, die Bäume, Dörfer, Häuser und sogar die Art und Weise, wie der Rauch aus den Schornsteinen aufsteigt.
Ich muss eine Zeitung und Haargel kaufen. Mehr habe ich mir nicht vorgenommen. Mein Vorsatz, mein Plan. Wenn ich mir jeden Tag etwas vornehme, egal wie banal, schaffe ich es vielleicht, mich nicht aufzulösen. Das spüre ich. Ich muss mich an die materielle Welt klammern. Mir konkrete Ziele setzen. Tag für Tag werde ich mein französisches Leben auf diese Weise mehr abstreifen und in mein deutsches Leben eintauchen; ich werde diese Umwandlung schaffen und Simon sagen können, dass es möglich ist. Ich bin als Kundschafterin aufgebrochen, dabei habe ich gar nichts von einer Forscherin an mir. Ich werde ihm sagen, dass es nichts bringt, in einer zerrissenen Familie zu bleiben. Dass er sich ebenfalls in Bewegung setzen muss. Aber Simon hat Angst um Mama. Er denkt, dass er bei ihr bleiben muss, bis sich die Lage geändert hat. Ah, ich muss auch Tintenpatronen für meinen Füllfederhalter kaufen. Wir steigen wieder ins Auto, und Frau Bergen hält auf dem Parkplatz des Supermarkts an, demselben wie am Vortag. Ich bin enttäuscht, ich wäre lieber durch die Straßen im Zentrum geschlendert, ich hätte gern andere Leute getroffen, wäre in die Läden gegangen, um zu sehen, wie der Alltag hier ist. Und als wir danach nach Hause fahren, frage ich mich, warum Frau Bergen mich überhaupt mitnehmen wollte. Ich bin zu nichts nütze, ich fühle mich sogar lästig, aber ich bilde mir ein, dass sich alles bald regeln wird. Ich muss mich in Geduld üben. Aber ich möchte, dass mir jemand eine Rolle zuweist. Ich brauche einen festen Rhythmus, ein Drehbuch, ich muss wissen, wohin ich gehe.
Ich bügle weiter, da ich nichts anderes zu tun habe. Ich werde bis zum Essen durchhalten, ich weiß nicht, ob ich vorschlagen soll zu kochen. Thomas geht nach oben in sein Zimmer, Nina ebenfalls, doch sie kommt wenig später wieder herunter und weiß offenbar nicht, was sie mit sich anfangen soll. Sie sucht in den Schränken nach etwas Essbarem, aber Frau Bergen schickt sie mit einem kurzen, trägen Satz ohne wirkliche Intonation wieder aus der Küche. Deshalb legt sich Nina schließlich im Wohnzimmer auf das Sofa und wartet darauf, dass der Tag vergeht. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Familie. Ich hoffe, dass ich bald begreifen werde, was es ist, es sei denn, es ist nichts und
ich
bin es, mit der etwas nicht stimmt, weil ich den Blick für die Normalität verloren habe. Aber ich lebe nicht im selben Rhythmus, das Fehlen des Zeitmaßes, das diese vier steuert, ist mir fremd. Ich werde meinen Platz in diesem Haus finden müssen, wo der Platz eines jeden schwebend, haltlos und flüchtig zu sein scheint. Ich würde Nina zum Beispiel gern bei den Hausaufgaben helfen, auf diese Weise hätte ich die Zeit irgendwie eingeteilt und würde von mir aus etwas tun. Ich kenne aber nur das Wort »Arbeit« für Hausaufgaben, ein Wort, das meine Eltern Tag für Tag wie ein unheilvolles Leitmotiv aussprachen, wenn sie meinen Bruder und mich fragten, ob wir unsere Arbeit gemacht hätten; auf diese Weise blieb es ihnen erspart, über andere Dinge zu sprechen, und wir ertrugen dieses Wort nicht mehr, da sich in ihm die ganze Angst unserer Eltern fokussierte. Denn wenn wir unsere Arbeit gut gemacht hatten, waren sie erleichtert, wenn wir gute Noten nach Hause brachten, waren sie beruhigt, Arbeit war ihr einziges Gesprächsthema, ihr Richtmaß. Und als ich dieses Wort aussprechen und Nina vorschlagen will, ihr bei ihren Schulaufgaben zu helfen, kommt mir der Satz »Arbeit macht frei« in den Sinn, den ich einige Monate zuvor in einer Geschichtsstunde gehört hatte, und ich wage plötzlich nicht mehr, mich auf dieses vermutlich riskante Terrain zu begeben. Denn bevor ich die Worte herausbringe, stoßen sie in meinem Gehirn aneinander, und ich sage mir, dass das Wort »Arbeit« für die Deutschen bestimmt einen ganz anderen Beigeschmack hat als für uns Franzosen, und das bremst mich in meinem Elan, und ich bringe nur einen hinkenden,
Weitere Kostenlose Bücher