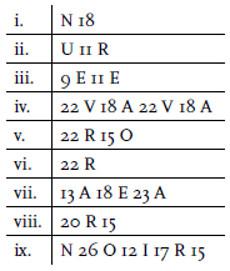![Das Fulcanelli-Komplott (German Edition)]()
Das Fulcanelli-Komplott (German Edition)
möglicherweise haben sie in Erfahrung gebracht, wo Sie zu finden sind. Ich fürchte, sie werden nicht sehr zimperlich mit Ihnen verfahren. Deswegen möchte ich, dass Sie das hier nehmen.» Ben nahm ein dickes Bündel Banknoten hervor.
Clément riss die Augen auf, als er sah, wie viel Geld es war. «Wofür ist das?», fragte er mit zittriger Stimme.
«Dafür, dass Sie eine Weile von hier weggehen, Monsieur», erwiderte Ben. «Kaufen Sie sich neue Sachen zum Anziehen und gehen Sie zu einem Arzt. Steigen Sie in einen Zug und fahren Sie fort, so weit Sie können. Mieten Sie sich für einen Monat oder zwei ein Zimmer in einem Hotel.» Er griff erneut in die Brusttasche und zeigte Clément ein zweites Bündel Banknoten. «Und das hier gebe ich Ihnen auch noch, wenn Sie mir dieses Buch verkaufen.»
Kapitel 23
«Interessant?»
«Ziemlich interessant», antwortete er abwesend und blickte von seinem Schreibtisch auf. Roberta starrte gelangweilt aus dem Fenster, einen Kaffeebecher in der Hand. Er wandte sich wieder dem Journal zu, blätterte vorsichtig die vom Alter vergilbten Seiten um und überflog die Eintragungen in der eleganten, geübten Handschrift des Alchemisten.
«War es dreißigtausend wert?»
Ben antwortete nicht. Vielleicht war es die dreißigtausend Euro wert gewesen, die er Clément dafür gezahlt hatte, vielleicht nicht. Viele Seiten schienen zu fehlen, andere waren beschädigt oder nicht mehr lesbar. Er hatte gehofft, in Fulcanellis Journal Hinweise auf das fabelhafte Elixier zu finden, vielleicht sogar eine Art Rezeptur. Doch als er die Seiten durchblätterte, erkannte er, dass das wohl ein naiver Wunschtraum gewesen war. Es schien sich um ein ganz gewöhnliches Tagebuch zu handeln, einen tagtäglichen Bericht über das Leben des Mannes, geschrieben aus der eigenen Perspektive.
Bens Augen blieben auf einem längeren Eintrag haften, und er begann zu lesen.
9. Februar 1924
Der Aufstieg auf den Gipfel war lang und voller Gefahren. Ich werde allmählich viel zu alt für diese Dinge. Mehr als einmal wäre ich um ein Haar zu Tode gestürzt, während ich mich wie betäubt zentimeterweise die nahezu senkrechte Felswand hinaufschob und der Schneefall sich zu einem ausgewachsenen Blizzard steigerte.
Endlich hatte ich den letzten Meter überwunden und den Gipfel erreicht, wo ich schnaufend und zitternd von der Anstrengung meinem geschundenen, müden Leib einige Minuten Ruhe gönnte. Ich wischte mir den Schnee aus den Augen und hob den Blick. Vor mir stand die Burgruine.
Der Lauf der Zeit hat nicht viel übrig gelassen vom einstigen stolzen Hort von Amauri de Lévis. Kriege und Seuchen kamen und gingen, Kriegerdynastien stiegen auf und versanken wieder, das Land wurde von einem Herrscher zum nächsten weitergereicht. Es ist mehr als fünf Jahrhunderte her, dass die Burg, schon damals alt und baufällig, im Zuge einer längst vergessenen Fehde belagert, bombardiert und schließlich geschleift wurde. Die einst starken runden Türme sind kaum mehr als Trümmerhaufen, die vom Kampf gezeichneten Wälle und Mauern überwuchert von Moos und Flechten. Vor langer Zeit muss ein Feuer im Innern gewütet und das Dach zum Einsturz gebracht haben. Die Zeit, der Wind und das Wetter haben den Rest besorgt.
Ein großer Teil der Ruine ist von wilden Brombeeren und Ginstersträuchern überwuchert, und ich musste mir erst einen Weg durch den gotischen Torbogen des Eingangs schneiden. Die Tore aus Holz sind längst verrottet und verschwunden. Nur die geschwärzten eisernen Angeln sind noch übrig, die von den rostigen Nieten im zerfallenden Steinbogen festgehalten werden. Als ich durch das Tor trat, empfing mich eine friedhofsgleiche Totenstille, die über der leeren grauen Hülle lastete. Ich hegte die größten Zweifel, ob ich jemals finden würde, weswegen ich hergekommen war.
Ich wanderte im schneebedeckten Innenhof umher und betrachtete die Reste der Wälle und Mauern. Am Boden einer gewundenen, in die Tiefe führenden Treppe entdeckte ich den Eingang zu einem alten Lagerraum, wo ich Zuflucht vor dem Wind und der Kälte fand und ein kleines Feuer entfachte, um mich daran zu wärmen.
Der Schneesturm hielt mich zwei volle Tage im Innern der Burgruine gefangen. Ich lebte von den mageren Rationen an Brot und Käse, die ich mitgebracht hatte. Ich hatte außerdem eine Decke und einen kleinen Stieltopf, den ich benutzte, um Schnee zu Trinkwasser zu schmelzen. Ich verbrachte die Zeit damit, die Ruine zu erkunden, in der
Weitere Kostenlose Bücher