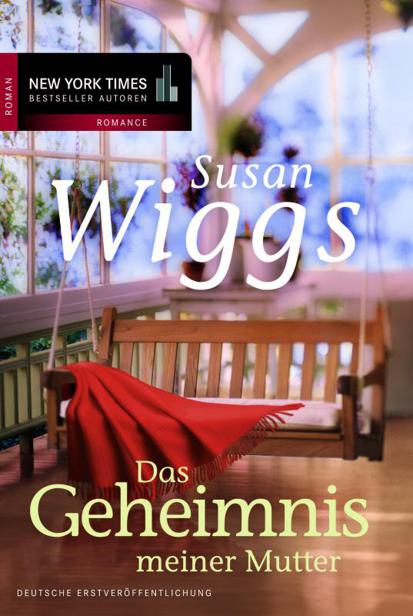![Das Geheimnis meiner Mutter]()
Das Geheimnis meiner Mutter
Sie würde die Sachen erst einmal aufbewahren und später entscheiden, was damit geschehen sollte. Sie trat einen Schritt zurück und verschränkte die Arme. Ihr war kalt, und sie stampfte mit den Füßen auf, um etwas warm zu werden. Ihre Lieblingshandschuhe waren ebenfalls dem Feuer zum Opfer gefallen. Sie waren aus Leder und mit Kaschmir gefüttert gewesen.
Rourke bog in die Einfahrt und parkte sein Auto hinter dem Lieferwagen. Als Teil seiner Initiative zur Verhinderung von Verbrechen war er heute an der örtlichen Junior-Highschool gewesen und trug noch die dementsprechende Kleidung. Er glaubte, dass die Uniform, oder sogar ein Anzug, ein Hemmnis für die Kommunikation mit Kindern war. Also trug er eine lässige Cargohose, Stiefel, die nicht ganz bis oben geschnürt waren, eine weite Jacke und eine Strickmütze. Er sah mehr wie ein Snowboarder als wie der Polizeichef aus. „Was geht?“, fragte er beim Herankommen.
„Alles“, sagte sie und deutete auf den Truck. „Wie war dein Besuch in der Schule?“
„Ich denke, sie mögen mich. Ungefähr ein Dutzend Kinder haben sich für freiwillige Gemeindedienste angemeldet.“
Sie konnte sich nicht vorstellen, wie irgendjemand ihm widerstehen konnte, egal ob Kind oder Erwachsener. Kinder erkannten ein falsches Lächeln schon von Weitem, und Rourke schien das zu wissen. Er wirkte vollkommen entspannt in seiner lockeren Aufmachung und nicht wie für die Jugendlichen verkleidet. „Wie kommt es, dass du so gut mit Kindern zurechtkommst, Chief?“, fragte sie.
„Man hört ihnen zu und zeigt ihnen Respekt, und danach wird es immer leichter. Wieso siehst du mich so komisch an? Liegt es an den Klamotten?“
„Nein, nicht die Klamotten.“ Sie zögerte. Ach, was soll’s, dachte sie. „Wünschst du dir jemals, selber Kinder zu haben?“
Er schaute sie erstaunt an und brach dann in lautes Lachen aus.
„Das sollte nicht lustig sein“, sagte sie. „Ich frage mich schon die ganze Zeit, was für ein Vater du wohl wärst und was für ein Familienmensch.“
„Keine Art von Vater und kein Familienmensch, danke vielmals.“
„Ach, komm schon, McKnight. Du bist nicht das erste Kind mit einer lausigen Kindheit. Das ist keine Entschuldigung.“
„Da gibt es noch die kleine Schwierigkeit, die Kinder zu bekommen, von denen du so überzeugt bist, dass ich sie haben will. Das ist für einen Mann nicht so einfach.“
Sein Blick, mit dem er sie musterte, war viel zu intim. „Hör mal, wir müssen unbedingt über unser … Arrangement sprechen. Es ist verrückt, dass ich bei dir wohne.“
„Warum?“
„Weil wir keine Beziehung haben.“
„Vielleicht sollten wir das aber“, sagte er. „Als Zimmergenossen.“ Er drehte sich abrupt um und ging um den Lieferwagen herum, um zu gucken, was die Bergungstruppe alles gefunden hatte.
Zimmergenossen, dachte Jenny. Was soll das denn heißen? Sie wusste nicht, wie sie ihn danach fragen sollte, also wechselte sie das Thema. „Ein kleiner Lieferwagen voll. Schon ein bisschen armselig, oder?“
„Nein“, widersprach er. „Das ist nicht armselig, sondern einfach nur etwas, was passiert.“
„Und es ist doch armselig“, wiederholte sie. „Warum lässt du mich nicht ein bisschen jammern?“
„Okay. Wenn du dich dann besser fühlst.“
„Das werde ich nicht, aber es lässt dich sich schlechter fühlen, und dann fühle ich mich besser. Ich bin eine Steuerzahlerin. Das ist das Mindeste, was du für mich tun kannst.“
„Meinetwegen.“ Er verschränkte die Arme vor der Brust. „Das Zeug hier zu sehen und zu wissen, dass nicht mehr von deinem Haus übrig geblieben ist … lässt mich mich schrecklich fühlen, okay?“
Ein fetter Pick-up-Truck mit einem Schneepflug fuhr vor. Als Erster sprang Connor Davis heraus, gefolgt von Greg Bellamy. Greg war Philip Bellamys jüngster Bruder, was ihn zu Jennys Onkel machte, obwohl er nur wenige Jahre älter war als sie. Er war erst vor Kurzem geschieden worden und mit seinen beiden Kindern Daisy und Max hierher nach Avalon gezogen. Daisy würde demnächst in der Bäckerei mithelfen. Max war in der fünften Klasse. Wie alle Bellamys, die Jenny bisher kennengelernt hatte, besaß auch Greg eine umgängliche, charmante Art verbunden mit dem natürlich guten Aussehen der gebildeten Klasse. Sie fühlte sich überhaupt nicht wie eine Bellamy, und dieses sonnige, vornehme Aussehen war komplett an ihr vorübergegangen. Jeder, der ihre Mutter kannte, schwor, dass sie genauso aussah wie
Weitere Kostenlose Bücher